

M103 A2 Kampfpanzer
RC Modell im Maßstab 1:16
Autor
Th. Schrecke 26.09.2022-25
Alle Modellbilder Copyright ©48Special Models/Thorsten Schrecke
2022-25
Alle Originalbilder Quelle Internet
Letztes update 01.08.2025
|
Zum Modell
Der
M103 wurde in den späten 1950er Jahren als schwerer Kampfpanzer
mit 120mm Kanone entwickelt. Unterschieden werden die Versionen M103,
M103A1 und M103A2. Der wesendliche Unterschied zwischen dem M103A1 und
dem A2 ist die Mototrisierung, die sich äußerlich in einer
Änderung des Heckbereiches äußert. Der A2 hat fast den
gleichen Heckbereich wie der M60A1.
Der M103 wurde nur in geringen
Stückzahlen gebaut, verglichen mit der M60 Familie. Die Version
M103A2 hatte lediglich 300 Exemplare, von denen 72 in Europa
stationiert waren. Der Rest wurde zumeist von den US Marines genutzt.
Der
M103 kam 1959 zur Truppe und die meisten Exemplare der A1 Version gingen
direkt zu den Marines nach Vietnam. Die Motorisierung des A1 war aber
zu schwach und so folgte eine Aufrüstung zum A2. Das Fahrzeug war
wegen der sehr lange 120mm Kanone sehr speziell und im Dschungel
Vietnams nur bedingt von nutzen.
Daher wurde ein Teil der Panzer an
die Truppen in Europa weitergegeben. Hier war der Panzer bis Mitte
der 1970er im Einsatz und macht durch seine schiere Größe
Eindruck.
Ich kann mich noch an dieses Fahrzeug erinnern, welches
auch für kurze Zeit in unserer örtlichen Kaserne auftauchte,
damals im farbenfrohen MASSTER Anstrich.
Ich bekam von meinem
Vater damals ein ROCO Modell des M103 im Maßstab 1/87 (H0) und
seitdem war ich auf der Suche nach einem größeren Modell.
Dragon hat vor einigen Jahren den M103 als 1/35 Bausatz geliefert,
dieser hat aber einige kleine Fehler, was mich zur genaueren Recherche
im Internet veranlasste und mich zu einer Seite mit einer sogenannten
"Walk around"-Fotostrecke führte.
Eine weiter Suche im Netz zum M113 als RC-Modell in 1/16 brachte mich zu einen Webshop aus Hong Kong namens DKLMRC der unter der folgenden URL erreichbar ist:
https://www.dklmrc.com
Das besondere an den OKMO Design Modellen von DKLMRC
ist, daß sie fast komplett aus dem 3D-Drucker kommen. Alle Teile werden
auf Industriedruckern aus unterschiedlichen Materialien perfekt
Originalgetreu gedruckt. Auch die Fahrwerksteile sind aus extrem
blastbarem Kunststoff gedruckt. Nur die Ketten und das Metall
Antriebsrad des M113 sind Serienfertigung.
Mit
dem Betreiber hatte ich eine Konversation über E-Mail zum M113A3
Modell, welches ich schließlich auch bestellt habe und
demnächst bauen werde. Wir sprachen auch über den M60 den er
im Angebot hat und dabei bekundete ich mein Interesse an einem M103.
Ich hatte im Internet nach einem Anbieter eines passenden Bausatz in 1/16 gesucht aber nichts gefunden.
Er
teilte mir dann mit, daß er diesen auch produzieren würde aber
derzeit nicht im Shop anbiete?! Ich fragte nach was mich so ein Modell
kosten würde und er meinte er habe noch einen auf Lager den ein
Kunde nicht abgenommen hätte. Wir wurden uns handelseinig und das
Abenteuer DHL begann!
Das Paket mit dem Bausatz war laut DHL-Sendungsverfolgung
schon nach 3 Tagen in Frankfurt im IPZ, um sich dann 11 weitere Tage
nicht vom Fleck zu rühren. Erst meine Nachfrage bei DHL brachte
das Paket wieder in Bewegung und nach Zahlung der fälligen
Einfuhrmehrwertsteuer, in Bar an der Haustür (weil Kartenzahlung
angeblich nicht möglich sei! Es lebe Industrie 4.0!!) hielt ich den
ersehnten Bausatz in Händen.
Äußerlich war das
Paket unbeschädigt, hatte aber eine Dell in der Seite (woher kann
man nur vermuten). Beim Auspacken stellte sich dann heraus, daß
das Schutzblech hinten, links abgebrochen war. Der Schaden ließ
sich mit etwas Sekundenkleber schnell beheben, zeigte aber gleich eine
Schwachstelle am Modell auf.
Die Verbindung der Schutzbleche zum
Oberwannenteil sind sehr dünn bei diesem Modell. Das Original hat hier
eigentlich keine durchgehende Verbindung. Die Bleche sind von oben und
unten nur an einigen Stellen mit der Wanne verbunden. Für den
Bausatz hat man aber Oberwanne und Bleche zu einem vorderen und einem
hinteren Oberwannenteil verbunden, mit entsprechenden Schwachstellen, an denen
das Teil gerne und leicht bricht. Mehr dazu unten im Bildteil.
Der
M103A2 ist wie der M113A3 ein 3D gedrucktes Modell, nur die Laufrollen,
Antriebszahnrad und Kette stammen von Serien Modellen. Die Laufrollen
vom M26 Pershing, dem Urahn der ganzen M60 Serie und das Antriebszahnrad
und Kette vom M1A2, dem quasi letzten der Ahnenreihe. Kette und
Räder sind aus Kunststoff und da mir das nur bedingt gefällt,
orderte ich sogleich den Metallrollensatz des M26 Pershing und einen
Satz Antriebszahnräder des M1 aus Metall.
Leider klappte das nur bedingt gut und ich wartete einige Zeit auf Ersatz, denn der Antriebszahnrädersatz
bestand leider nur aus Innenteilen. Der M26 hat zudem eine Laufrolle
und eine Stützrolle zu wenig. So muß ich diese noch
zusätzlich besorgen.
Zum 3D gedruckten Modell kann man nur
sagen Toll!. Die Details sind superfein und vieles ist direkt
angedruckt, was üblicherweise zum Teileschinden als Einzelteil
kommt!
Dem
Kit liegen mehere Beutelchen mit Schrauben unterschiedlicher
Größen, Spiralfedern und diverse Kleinteile bei, aber keine
wie auch immer geartete Bauanleitung! Der Hersteller hat zu seinen
Modellen meist im Shop eine herunterladbare pdf-Datei verfügbar, aber die gibt es zu diesem Modell auch nicht, da
es derzeit im Shop nicht angeboten wird. Bezüglich der Schrauben
ist da der eigene Grips gefragt. Das die Spiralfedern in die Federbeine
des Fahrwerkes gehören versteht sich da schon fast von selbst, wo
aber welche Schraube mit welchem Gewinde hingehört sollte man
sorgfältig prüfen bevor man sie verbaut!
Einzig die für den 3D-Druck gewählte Kunststofffarbe ist unvorteilhaft. Das opake
Weiß läßt alles zu einem "white out" verschwimmen.
Besser wäre hier ein schwarzer oder grauer Kunststoff. Aus grauem Material
bestehen die Träger für die "Innereien", denn der Tank hat auch
innere Werte. Einen Motor-Getriebeblock mit kurzen Achsen, eine
Einbauwanne für die Elektronik (die gesondert gekauft werden
muß) und eine vordere Einbauwanne mit dem Getriebemotor für
den Turmantrieb samt Stahlzahnrad. Der Schwenkbereich beträgt 360
°!
Im Turm verbaut ist ein weiterer Motor der die
Kommandantenkuppel antreibt. Der Turm ist ein Monster und mit der
Kanone fast doppelt solang wie die Wanne.
Die Luken im Turm können geöffnet werden, genau wie die Fahrerluke in der Wanne.
Die Kanone
besteht aus einem vorderen Rohrteil, der innen mit eine GFK-Stab
stabilisiert ist, welcher bis in die Aufnahme an der
Rohrrücklaufeinheit führt. Die Mündung ist perfekt und
hat sogar Zügen die ca. 3cm ins Rohrinner verlaufen. Das
Rohr paßt sauber auf den Anschluß der Rohrrücklaufeinheit und kann dort angeschraubt werden. Die Rohrrücklaufeinheit
hat zwei Servos. Eine zum Heben und Senken des Rohrs und einen für
die genau gesteuerte Rohrrücklaufbewegung. Im vorderen Teil des
Turms, neben der Rohrrücklaufeinheit,
sind
Gewichte verbaut, die das Eigengewicht des ausladenden Turmhecks
ausgleichen. Der Turm ist auf Kugellagern gelagert und hat einen
demontierbaren Drehkranz. Eine Besonderheit ist, das der Turm mit dem
Drehkranz angehoben werden kann und so ohne viel Aufwand wieder in die
0-Position gesetzt werden kann.
Das Fahrwerk ist drehstabgefedert und
hat kugelgelagerte Schwingarme aus Kunststoff (Nylon), an die einzelne
Federdämpfer angebaut sind, die ebenfalls mit Spiralfedern
gedämpft werden!
Die untere Wanne besteht aus einem Stück
und ist komplett gedruckt! Diverse Kleinteile, wie die Anschlagfedern
für die Schwingarme und Details am Heck wie Licht, Kupplung und
Scharniere für die Motorraumtüren müssen noch
montiert werden.
Zur Stabilisierung der Wanne sind oben drei
Stahlrundstäbe eingebaut, die ein Verwinden verhinden sollen. Die
eingebauten Wannen für die Elektronik werden mit dem Wannenboden
verschraubt und geben den Ganzen zusätzlich halt. Ob das für
das Metalllaufwerk reicht muß ich erst noch feststellen.
Die
Oberwanne ist in einen vorderen und einen hinteren Teil unterteilt.
Der Vorderteil wird vorne mit zwei Metallgewindeschrauben gesichert und
hinten in eine stabile Einrastkerbe eingesetzt. Damit ist der feste
Sitz des Turms gewährleistet. Die Heckplatte gibt die
Motorabdeckung wieder und wird durch acht extrastarke Magnete gehalten.
Hier muß man aufpassen wo man die Platte anhebt sonst bricht
möglicherweise ein Teil ab.
Auf der Unterseite der beiden
Oberwannenteile sieht man, daß die Bleche im Bereich der Staukästen
und Auspuffschalldämpfer hohl sind. Um den Staukästen eine
gute Kontaktfläche zum Ankleben zu bieten, hat der Designer hier
die Innenseite angehoben. Normalerweise fällt das nicht weiter
auf, wer schaut schon unter die Kettenschürzen? Doch hier gibt es
keine und so habe ich als eine der ersten Amtshandlungen, in deutscher
Gründlichkeit, die Unterseiten geschlossen. Bei dieser Gelegenheit
konnte ich auch die Bruchstelle am Blech etwas verstärken. Siehe
Bilder.
Kleiner Hinweis an den Hersteller: Im 3D Druck lassen sich auch Hohlräume geschlossen drucken!
|
Der Bausatz
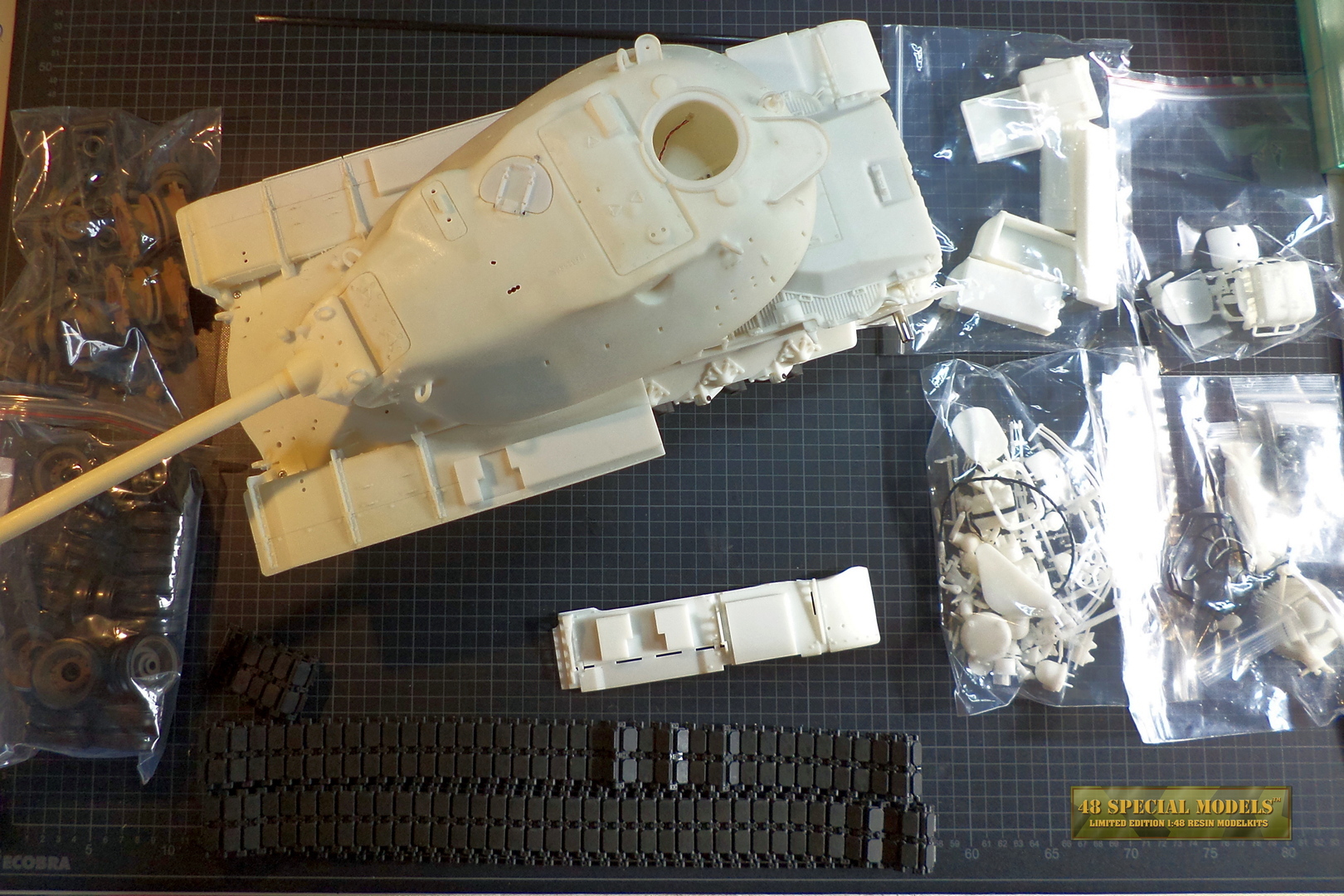 | 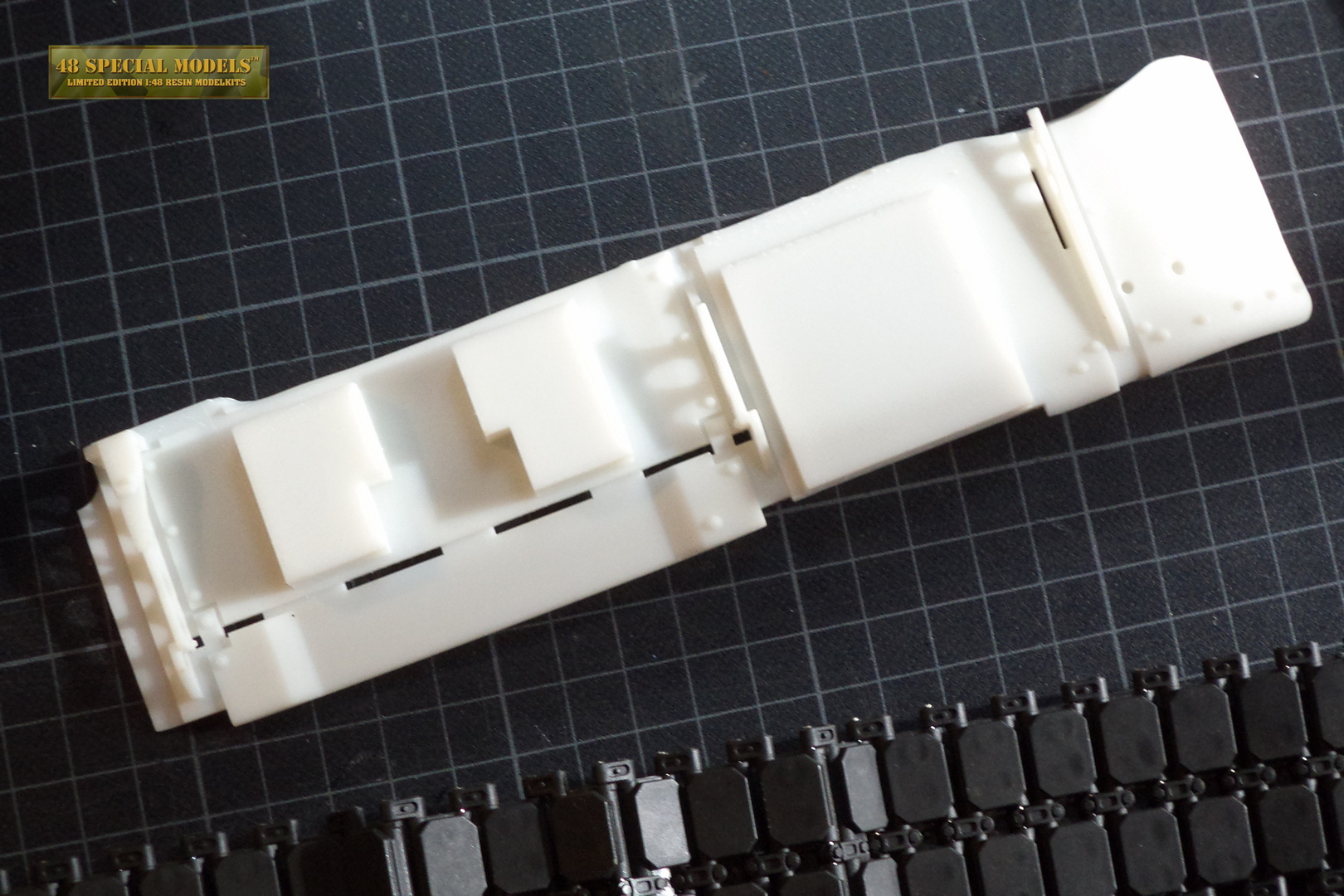 | Überblick über alle gelieferten Teile
| Das abgebrochene Kettenblech hinten links |  |  | | Turm und Unterwanne | Detail der Schwingarme | 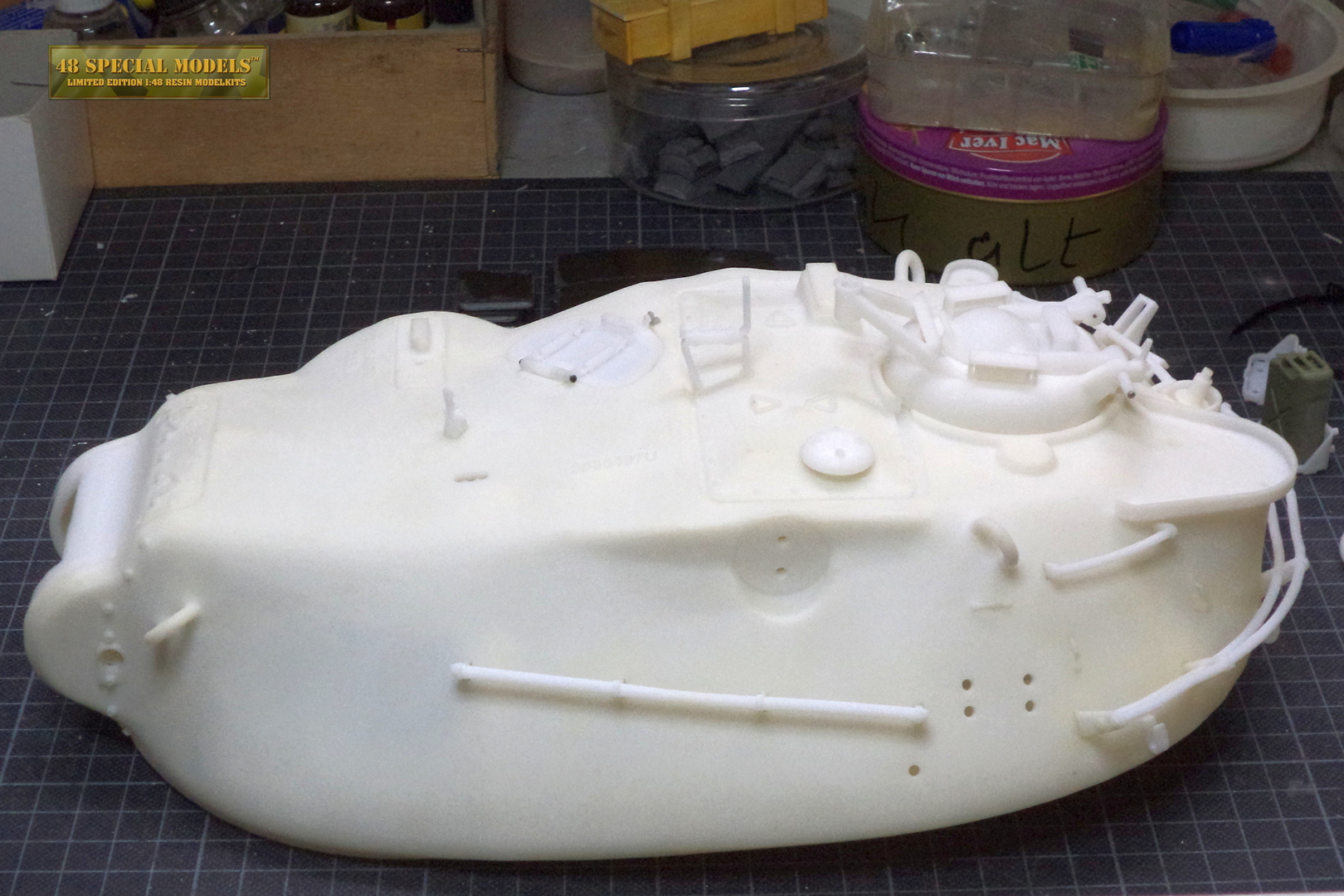 | 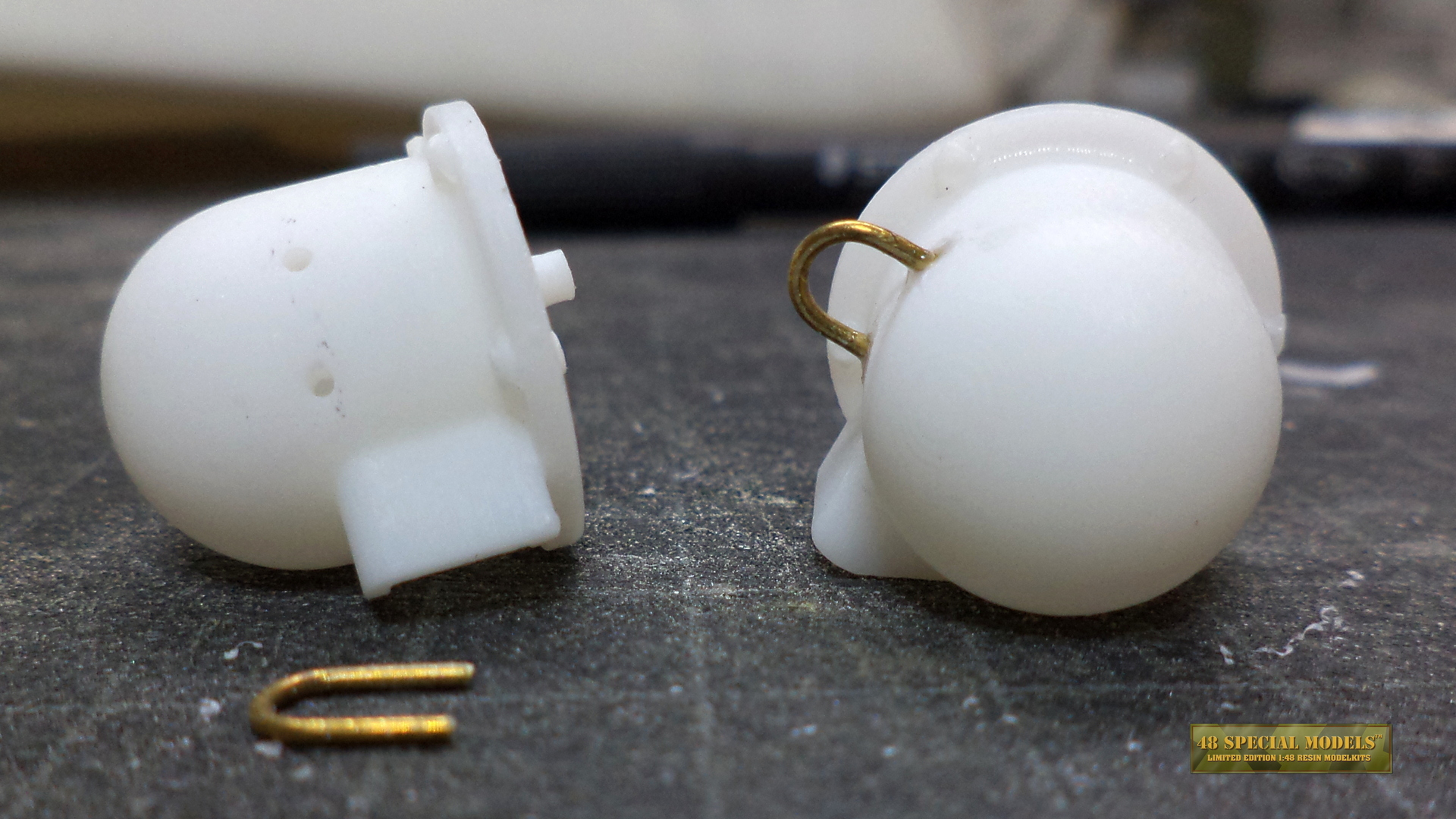 | | Der Turm mit den bereits angeklebten Detailteilen | Die Entfernungsmesserglocken bekommen die Hebeösen |  |  | | Blick in die entleerte Wanne | Mitgeliefert
wurde der linke, deutsche Kanistertyp. Richtig wäre der rechte US
Typ. Hier aus dem Kit von Classy Hobby, Artikel-Nr.: 16MC16008 | 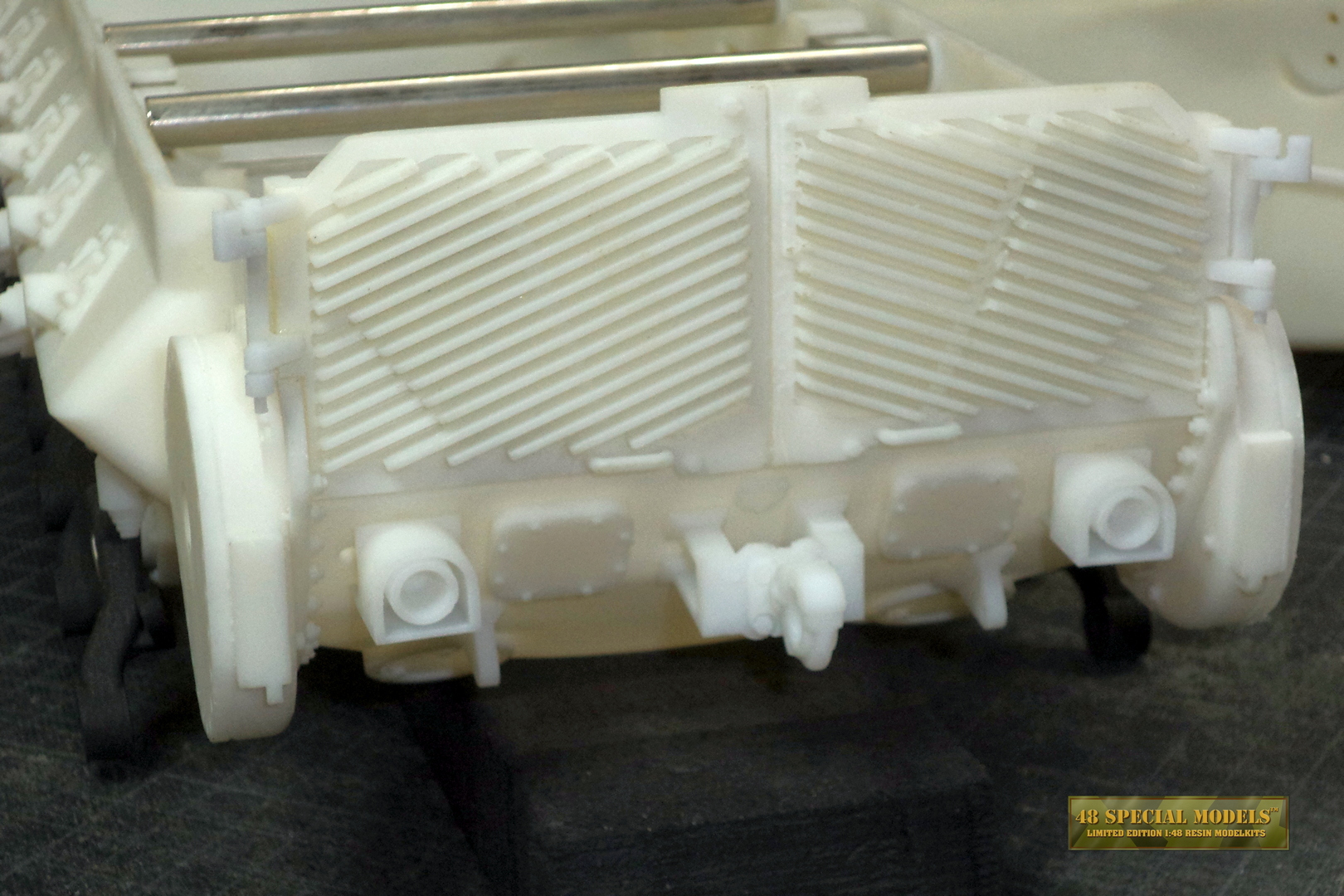 | 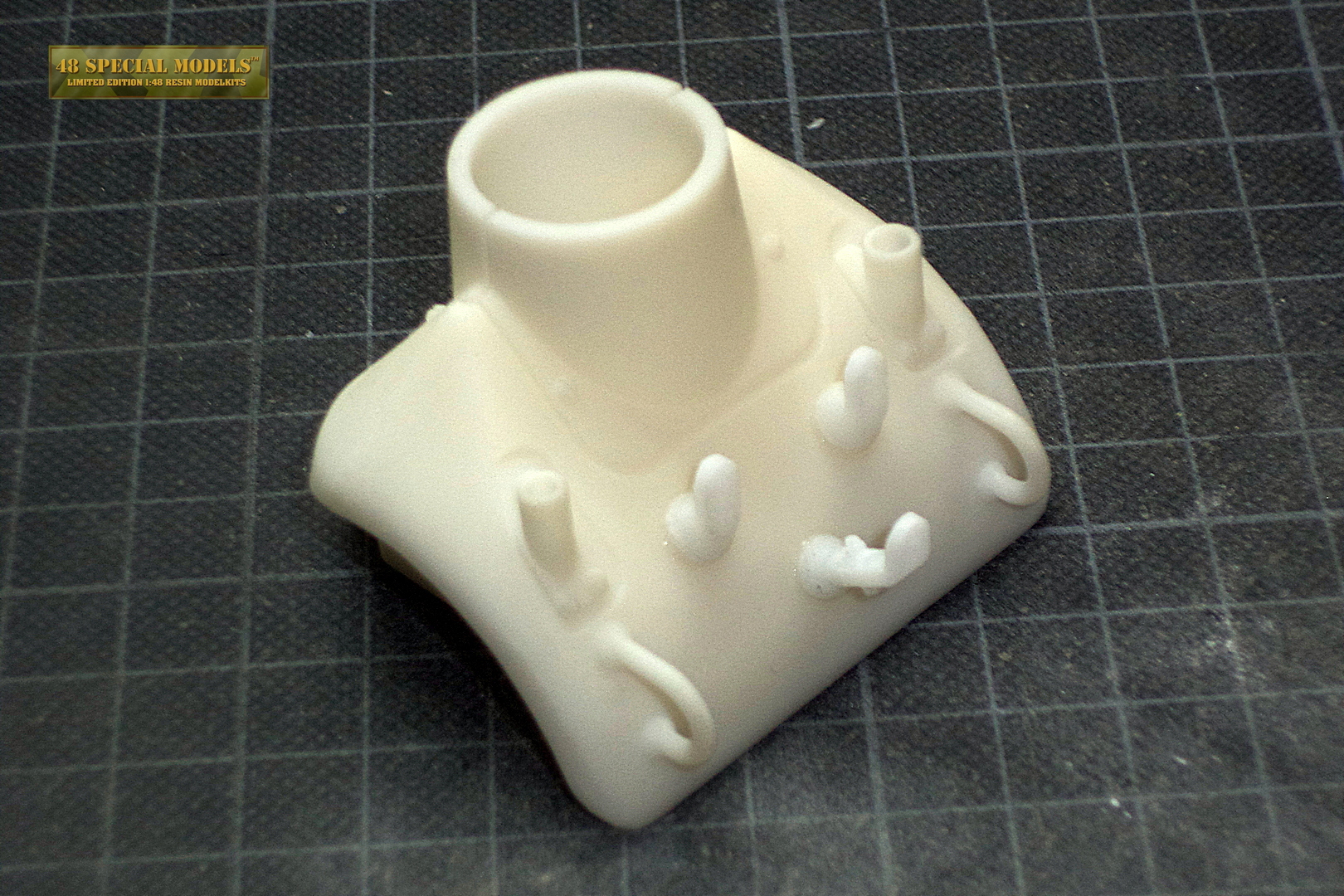 | | Die Rückbeleuchtungsaufnahmen sind nur aufgesteckt. Sie müssen erst noch lackiert und mit LEDs bestückt werden. | Die
Rohrblende mit den Anschlagpunkten für den Scheinwerfer. Dumm
nur, daß der von unten angeschraubt werden soll... |  | 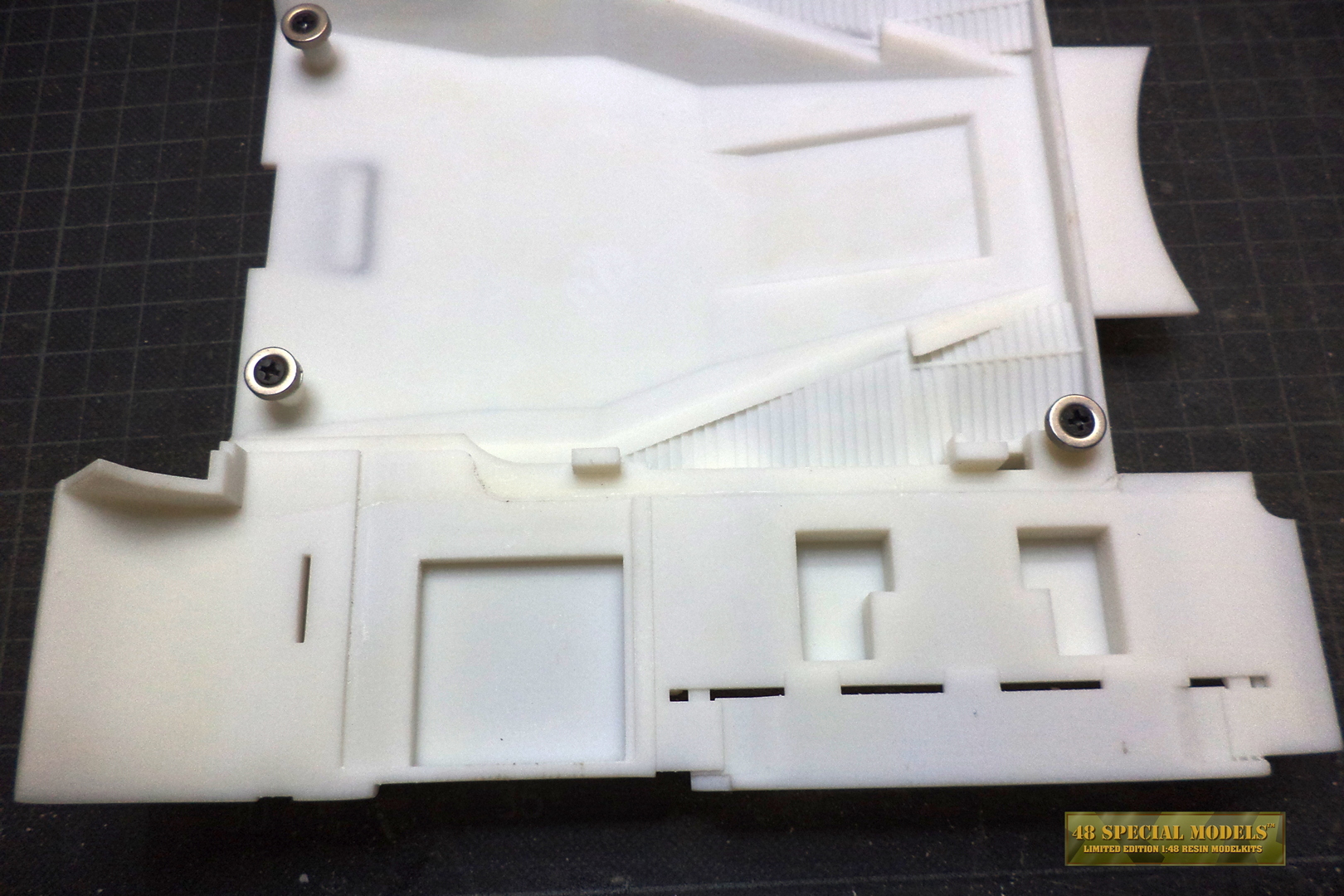 | | Unterseite
der Heckabdeckung. Deutlich sichtbar die Aussparung für den
Staukasten auf der Oberseite. Darüber verläuft die
Bruchkante, die nach dem Kleben kaum sichtbar ist. | Das sieht nicht nach meinem Geschmack aus und ist natürlich nicht
vorbildgetreu. | 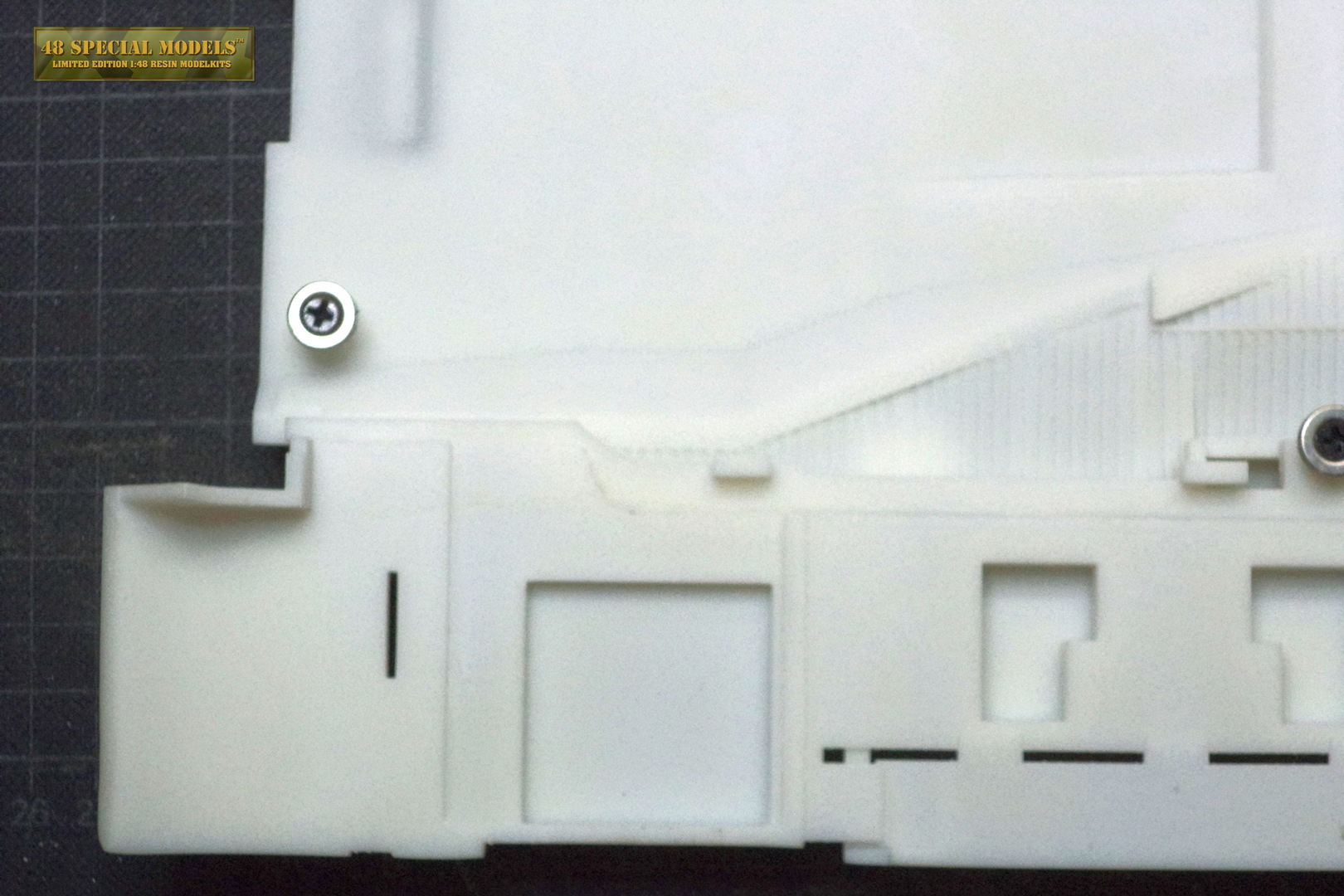 | 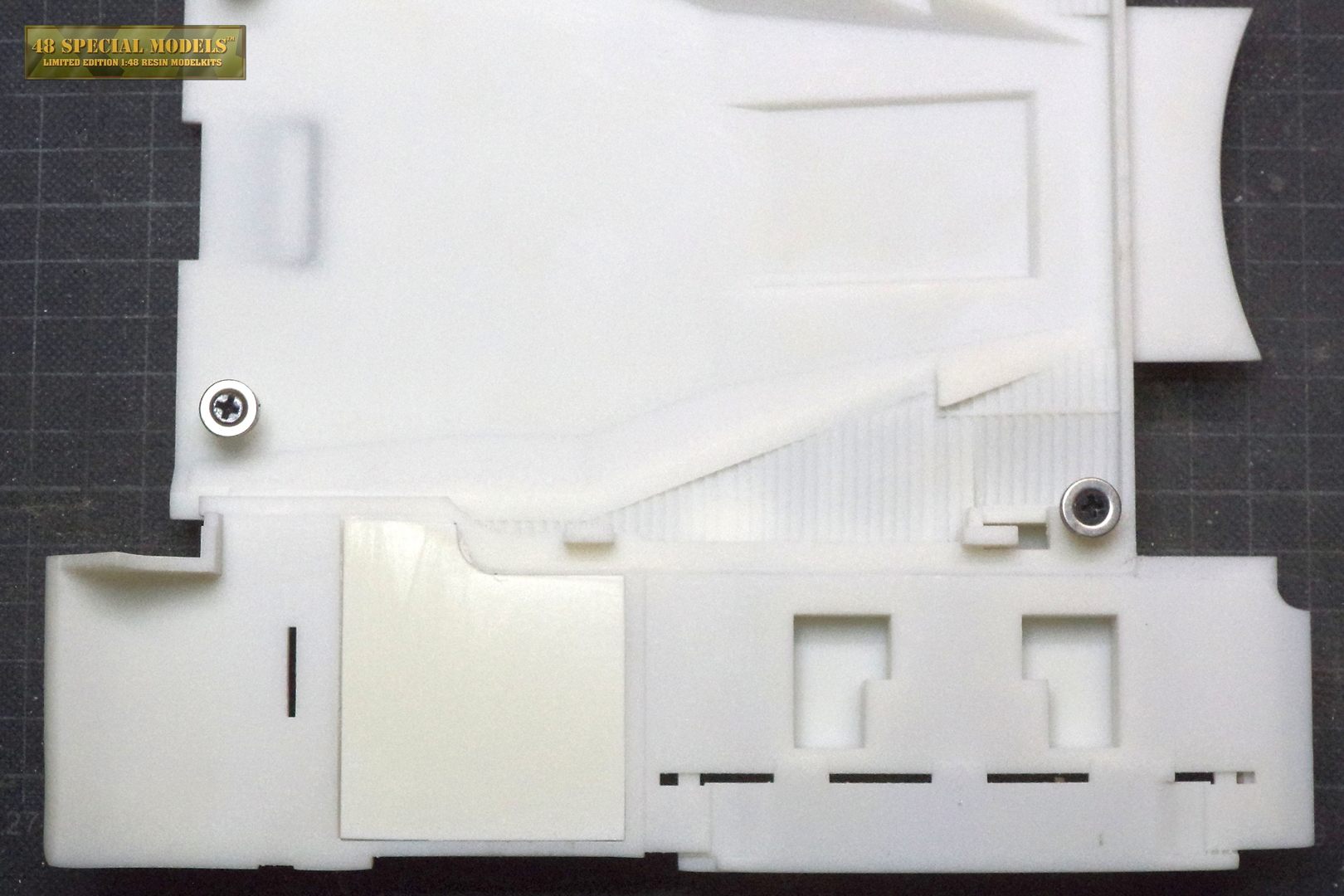 | | Aber dafür hat uns der Liebe Gott ja Polystyrolplatten in unterschiedlichen Stärken gegeben! | Einpassen, einkleben, beischleifen, fertig!
Die obere Ausweitung der eingeklebten Platte geht nun über die Bruchstelle hinweg und stabilisiert sie. |  |  | | Mit
einem 0,5mm dicken Streifen und langsam härtendem Sekundenkleber
werden die Ausparungen auf beiden Seiten überklebt. | Nur
noch sauber verschleifen, so das alles wie aus einen Guß wirkt
und dann lackieren. Auf die, auf der Unterseite des Bleches beim
Original vorhanden, Muttern der durchgeführten Schrauben verzichte
ich aber. | 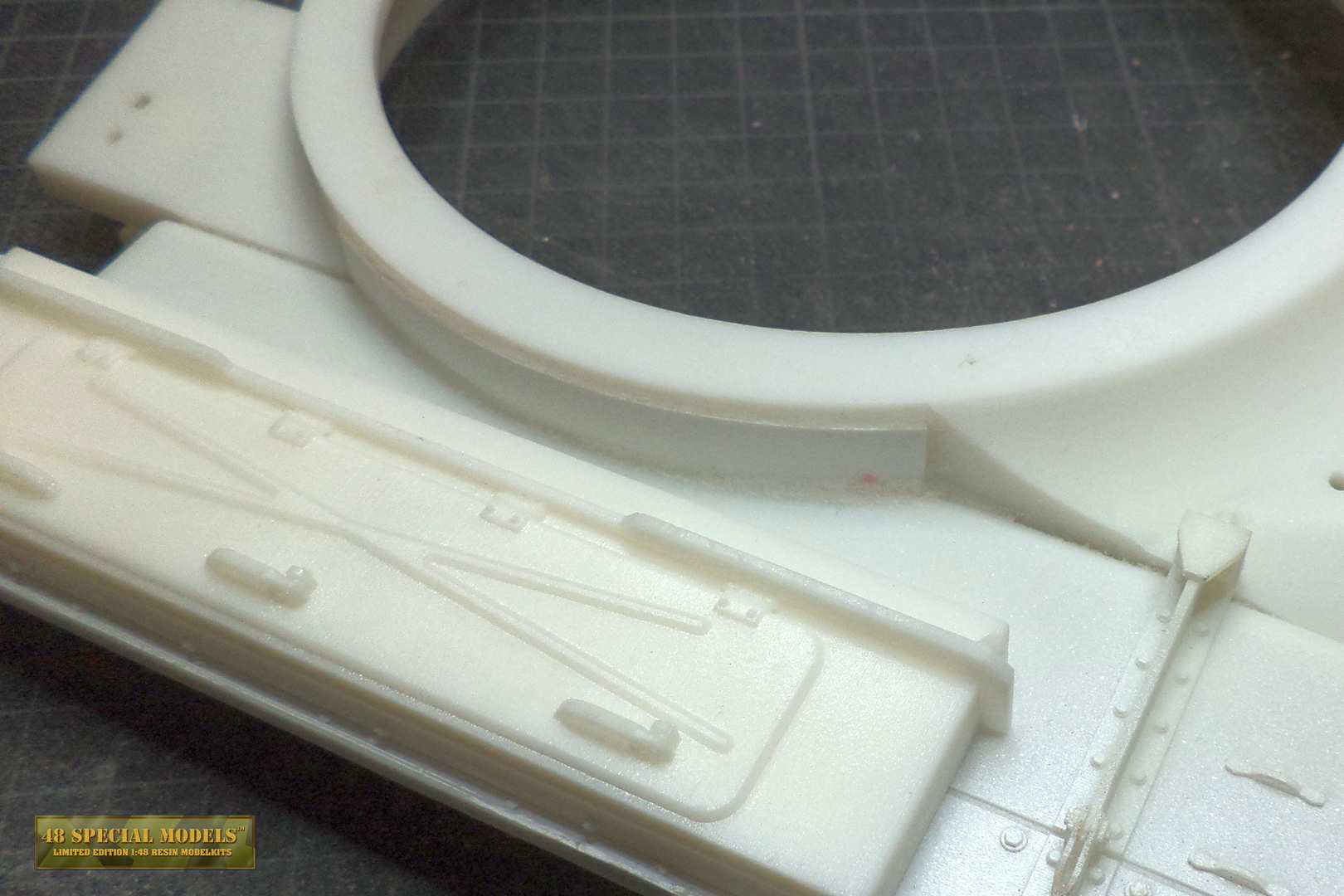 | 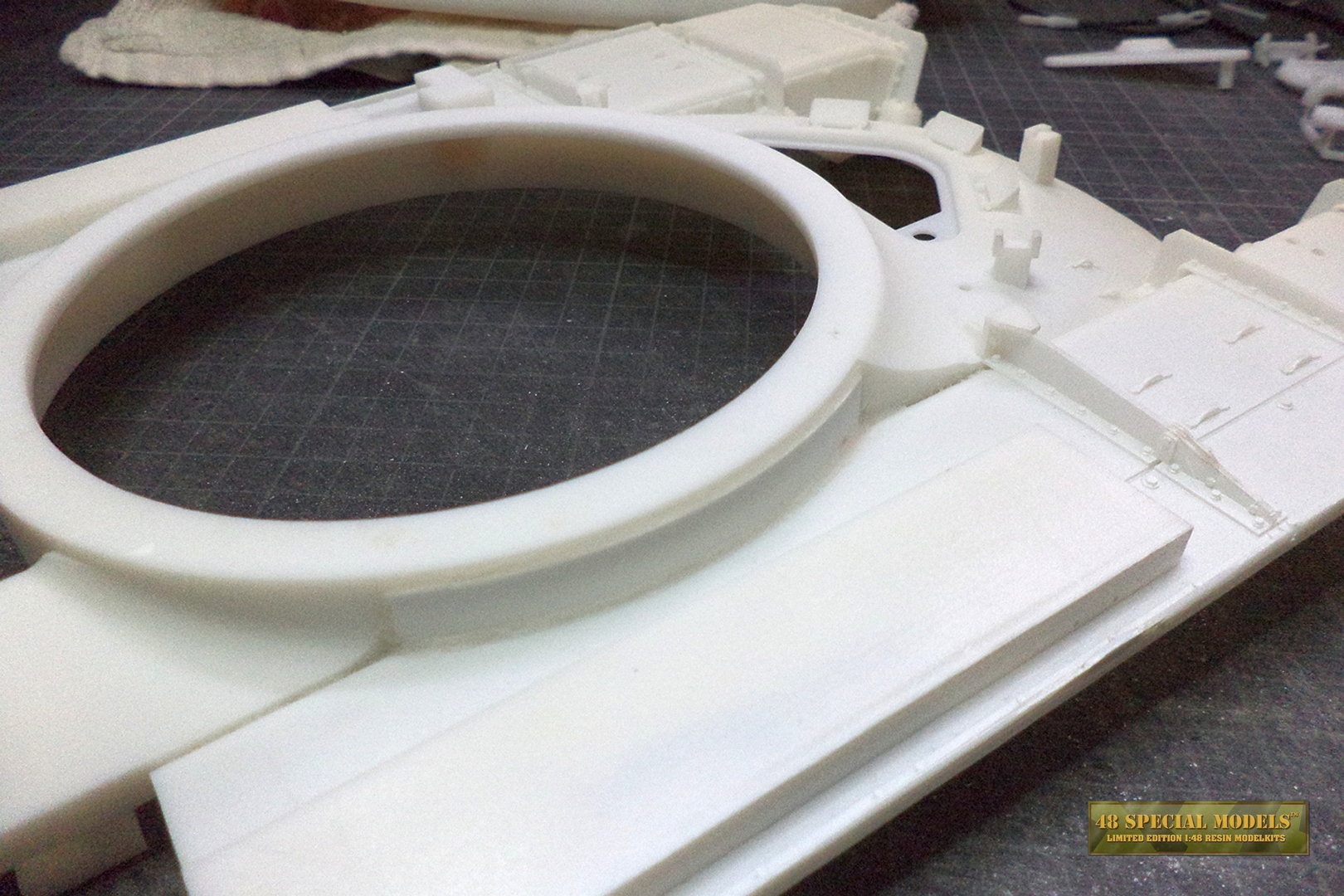 | Der Seitenstreifen am Turmring und der aufgesetzte Staukasten.
Beachte die Schräge rechts davon. | Die harte Abbruchkante an der Schräge der Frontblende ist nicht korrekt. | 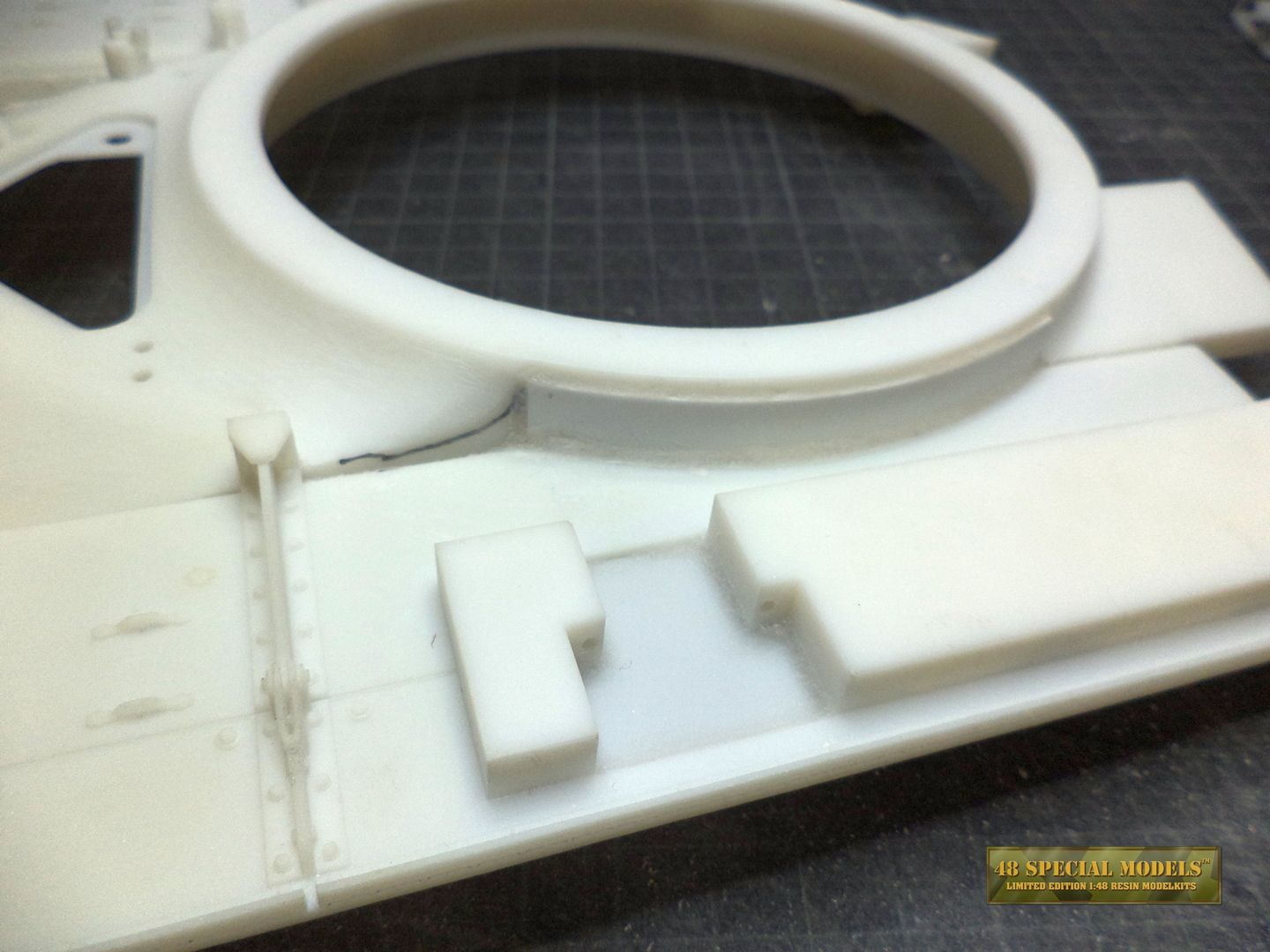 | 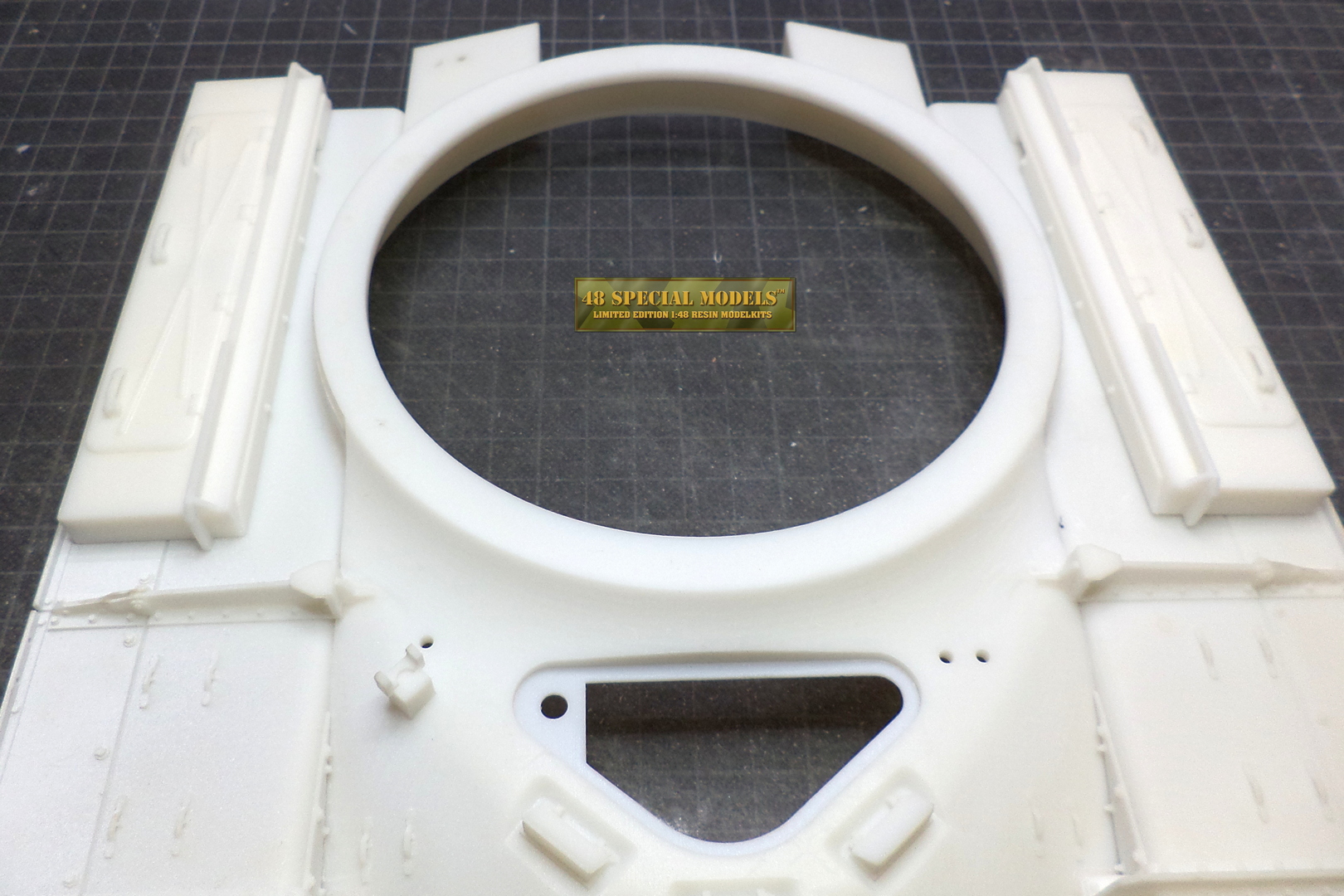 | | Sie müßte, wie hier bereits geändert, abgerundet sein! | Aus
dieser Perspektive erkennt man, daß die Staukästen geringfügig
zu schmal sind. Die Lücke zum Turm hin sollte schmaler sein. |
|
Zum Bau des Modells
Der
Zusammenbau des Modells unterteilt sich in zwei Hauptteile, die äußere Gestaltung und die Elektronik für den
Fahrbetrieb. Beide können weitgehend unabhängig voneinander
erfolgen. Allerdings gibt es einige wenige Schnittstellen, an denen man
sich entscheiden Muß was man zuerst erledigen muß.
In
diesem Fall macht mir die Grundfarbe des Modells das Leben unnötig
schwer. Das opake Weiß ist wie ein Schneesturm, man kann die
Oberflächendetails nicht erkennen. Das macht die Begutachtung der
Oberfläche fast unmöglich. Da sich bei 3D-gedruckten Teilen
gerne mal ringförmige Ebenenkanten abzeichnen, die man durch
abschleifen erst glätten muß, ist das weiß hier nicht
hilfreich.
Ich habe mir daher den Turm zuerst unter der
Lupenlampe mit Argusaugen angesehen und meinen Tastsinn bemüht, um
die Oberfläche zu analysieren. Anschließend befand ich sie
für gut genug um zuerst alle Kleinteile anzubringen, die
später auch mit der Sprühdose problemlos lackiert werden
können. Komplexere Teile nehme ich mir erst mit der Airbrush vor
und klebe sie anschließend auf den vorlackierte Turm. Dazu
gehören der Dom der Turmlüftung, der Prismenschutz des
Richtschützen und die beiden Glocken des Entfernungsmessers.
Da
dem Bausatz keinerlei Anleitung beiliegt, greife ich auf eine Bildserie
eines M103A2 aus Ft.Lewis zurück, die ich im Internet gefunden und
abgespeichert habe. Da ich meinen Laptop nicht
dem Staub der Werkstatt aussetzen will, habe ich die Bilder ausgedruckt.
Immer 4 auf eine Din-A4 Seite macht 22 Seiten an Details von allen
Seiten. Was hier nicht zu finden ist, muß ich dann in der
mittlerweile großen Bildsammlung auf dem Rechner suchen.
Diese
Bilder erklären alle Details des Äußeren des M103 aber
sagen nichts über das Innenleben und die Elektronik!
Daher
muß man sich das Modell erst mal genau ansehen und verstehen was
der Designer sich bei so manchem merkwürdigen Dingsbums gedacht
hat. Hierbei habe ich einige sehr positive Überraschungen erlebt
und gelernt, daß ich bei RC-Panzern noch viel lernen muß!
Als
professioneller Bausatzkonstrukteur und Detailkenner arbeitet bei mir
dann natürlich auch immer das Optimierungsgen mit.
Da
ich, was die Elektronik von RC-Panzern angeht, relativ unbeleckt bin und
nur die einfachen Heng Long Steuerungen kannte, mußte ich mich
erst mal ins Thema einarbeiten und mich schlau machen. Gelernt habe ich
das gute Elektronik ihren Preis hat und diesen dann auch wert sein
sollte und das mir derzeit die Mäuse dafür fehlen.
Daher
beschloß ich mich zuerste den äußeren Werten des
Modelles zu widmen und die inneren ruhen zu lassen bis ich sie mir
leisten kann.
Das bedeutet aber dennoch, daß einige
Elektronikarbeiten erledigt werden müssen bevor man lackiert oder
montiert.
So z.B. die Beleuchtung.
Für die Frontscheinwerfer gibt
es im Kit keine Klarsichtteile, ebensowenig für die
Rücklichter.
Daher muß ich mir diese aus einer anderen Quelle besorgen?!
Bevor aber die Lampenhalterungen montiert werden
können, müssen die LEDs verkabelt und eingelötet werden
und davor die Lampenhalterungen grundiert und lackiert werden. Das gilt
auch für den Scheinwerfer auf der Kanone. Bei letzterem hat
mich das fehlen einer Bauanleitung gleich mal auflaufen lassen.
Nachdem
ich die drei Befestigungspunkte an der Rohrblende festgeklebt hatte und
den Scheinwerfer zur Passkontrolle anhielt, stellte ich fest, das
letzterer von unten mit Microschrauben angeschraubt werden soll. Die
Schrauben liegen zwar bei, doch sind die drei Streben erst mal
eingeklebt kommt man mit keinem noch so dünnen Schraubendreher ran
um die Schrauben einzudrehen! Tja, jetzt hilft nur gut nachdenken. Die Lösung kommt weiter unten.
Leichter
war es da schon die Glocken der Entfernungsmesser mit den nötigen
Hebeösen nachzurüsten. Auf den Fotos waren mir diese
Hebeösen, die zum Ein- und Ausbau der schweren Stahlglocken
nötig sind, aufgefallen. Ihre Position und größe waren
gut nachzuvollziehen und so bog ich mir aus einem 0,8mm Messingdraht,
den ich um einen 4mm Feilengriff bog, zwei U-förmige Ösen.
Ich
zeichnete die Lochpositionen an und bohrte die vier Löcher mit
einem 1mm Bohrer. Dann entfernte ich die Marker Markierungen wieder, da
diese durch jeden Lack durchblühen! Ich gab einen Tropfen langsam
härtenden Sekundenkleber in jedes Loch und schob die vorher
angerauhten Ösen in die Löcher. Die Einbautiefe
läßt sich mit dem gleichen Feilengriff einfach dadurch
bestimmen, indem man ihn durch die Öse steckt. Anschließend
sauber ausrichten, kurz warten bis der Klebstoff anzieht, fertig.
|
Turmaußenseite
Da
der Turm recht markant ist und unabhängig von der meisten
Elektronik, abgesehen von den Motoren für die Turmdrehung und
Rohrsteuerung, bietet es sich an diesen zu Beginn zu bearbeiten, zumal
der Großteil der kleinen Anbauteile auf ihm montiert werden
müssen.
Vorher wird die Rohrmechanik samt Servos ausgebaut.
Wer sich deren Position und Einbau nicht merken kann, der sollte vor dem
Ausbau ein Foto machen!
Da der Kunststoff opak, also halbtransparent
ist, sollte man den Turm von innen und Außen grundieren, um ein
eventuelles durchscheinen von Lichtern zu vermeiden. Nichts sieht so
albern aus wie ein durchsichtiger Panzer!
Zuerst
montiere ich aber die kleinen Anbauteile die sich bequem mitlackieren
lassen. Komplexere Teile oder Hinterschneidungen vermeide ich, da ich
die Grundierung mit der Sprydose auftrage und diese solche
Stellen nicht gut erreicht. Daher diese Teile besser getrennt lackieren!
Dann erfolgt die
Zuordnung der einzelnen Kleinteile. Alle werden auf der
Arbeitsfläche angeordnet und dann nacheinander in ihrer Position
angehalten, aber noch nicht festgeklebt! Es geht nur darum
festzustellen wo was hinkommt und ob etwas fehlt!
Mir fiel dabei
auf, daß die vorderen Halter für das am Turm befestigte
Drahtseil nicht korrekt sind, bzw. fehlen. Im Kit sind nur die
U-förmigen Haken enthalten, die wie sich anhand einer
Bildrecherche ergab, beim M60 eingebaut sind. Ob beim M103A2 eine andere
Befestigung montiert war ergab erst eine genaue Bildrecherche. Beim A1
war generell kein Stahlseil an dieser Stelle verbaut. Beim A2 gab es
dieses Seil und die Enden wurden mit einem, mit einer Verschraubung
gesicherten, Bügelverschluß geschlossen, um das Seil bei
unruhiger Fahrt nicht zu verlieren.
Nach
der ersten Passprobe weiß ich nun wo welches Teil hingehört
und wie es montiert werden soll. Dabei zeigte sich, daß z.B. die
Bügel an der Rückseite etwas "verbogen" sind. Ich dachte
zuerst es sollte einen Gebrauchtlook eines bestimten Fahrzeuges
simulieren, mußte aber feststellen das es wohl nur ein
Druckerfehler war. Mein Lieferant hatte mich vorsorglich darauf
hingewiesen, daß sich verbogene Teile mit Wärme wieder in die
ursprüngliche Form bringen lassen. Je nach Größe kann
man heißes Wasser oder auch ein Feuerzeug nehmen.
Ich nutzte dazu die kleine Lötlampe und das ganz vorsichtig! Die verbogenen Bügel
wurden erwärmte und mit Hilfe eines Kunststoffreststreifens in
Form gebracht und so gehalten bis sie abgekühlt waren. Bei Bedarf
kann man das mehrfach wiederholen. Dabei habe ich darauf geachtet das
der Gebrauchtlook nur abgemildert wurde. Ich will ja kein fabrikneues
Fahrzeug.
Die Montage der Ersatzkanisterhalte erfolgt erst nach
der Abschlußlackierung im MASSTER-Farbschema. Die Halter sind in
der Regel einfach olivegün lackiert und nachträglich
angeschraubt. Da der mitgelieferte Kanistertyp ein deutscher
Wehrmachtskanister ist, muß ich beide Kanister durch
passende US Jerry Cans tauschen. Den Bausatz dafür gibt es von Classy Hobby:
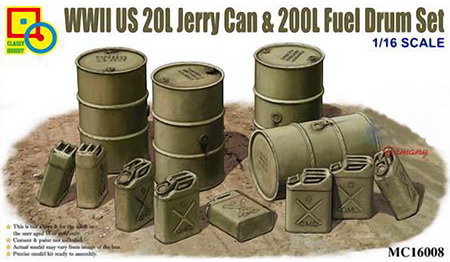 | US WWII 20 l Jerry Can & 200 l Fuel Drum Set
Plastikmodellbausatz im Maßstab 1/16
Kunststoffmodellbausatz der
unentbehrlichen Ersatzkanister und Kraftstoff Fässer.
Inhalt 8 Kanister und 4
Fässer.
Passend zum neuen Stuart (siehe oben).
Statisches Modell.
Hersteller: Classy Hobby
Artikel-Nr.: 16MC16008
Sofort
lieferbar!

|
Aber
Obacht, es gibt zwei unterschiedliche Typen, die sich am
Verschluß erkennen lassen und an der Beschriftung oben. Die
Kanister für Diesel sind die mit dem runden
Schraubverschluß, während die mit dem länglichen
Sicherungsbügel meist für Wasser genutzt werden! Ähnlich
wie bei der Wehrmacht werden die Wasserkanister häufig mit einem
weißen X markiert oder auch beschriftet. Bei moderneren US
Fahrzeugen werden meist schwarze Kunststoffkanister verwendet. Der
M103A2 stammt aus den 1960ern, da ist der Blechkanister noch
gebräuchlicher.
Da der Halter
für US Kanister gedacht ist passen die Kanister aus dem Classy
Hobby Bausatz genau hinein und können problemlos genutzt werden.
Herstellerseitig
wurde auch der passende Gurt zum festschnallen der Kanister mit samt
Schnalle geliefert. Der Gurt ist leider schwarz aber das kann man
ändern.
Da
ich das Modell später komplett aufgerödelt fahren will,
werden natürlich ein paar mehr Kanister beider Sorten
benötigt. Hätte ich eine M103A1 Version würden auch die
4x 200L Fässer auf einem Halter
am Heck verbaut, wie dies in den 1960ern häufig der Fall war, da
die A1 Version erheblich mehr Durst hatte als die A2 Version.
|
Schweißnähte
Als
nächstes werden alle Schweißnähte der Details am Turm
kontrolliert und gegebenenfalls nachmodelliert. Ebenso auf der
Wannenoberseite. Anhand der Fotos läßt sich jede
Schweißnaht finden und mit der am Modell vergleichen. An manchen
Stellen sind bis zu fünf Schweißnähte übereinander
gelegt und ergeben deutlich sichtbare Wülste.
Einfache
Schweißnähte erzeuge ich mittels langsam härtendem
dickflüssigem Sekundenkleber, welchen ich mit eine Kanüle
entlang der Schweißstelle auftrage und dann mit einem
Füllmittel bestreue. Ich nutze hierfür das selbe
Füllmittel wie für meine Resinabgüsse. Es ist ein
Aluminiumhydroxid dessen Vorteil es ist feinkörnig und gut
schleifbar zu sein. Dieses wird, aus einem feinen Streuer, der
einen feinen Strahl abgibt, vorsichtig auf die Klebenaht gestreut. Die
Naht muß ganz damit bedeckt sein, damit sich ein echt
wirkender Wulst bildet. Den überschüssigen "Sand"
schüttelt man ab und läßt alles gut trocknen,
dann mit einem Pinsel den restlichen Überschuß
abbürsten. Gegebenenfalls kann dieser Vorgang mehrfach wiederholt
werden.
Bei
diesem Modell sollte der Untergrund vorher mit Schleifpapier angerauht
werden, um die Haftung des Sekundenklebers zu verbessern!
Detailliertere,
strukturierte Schweißnähte
kann man auch mittels Epoxid Kitt erstellen. Dazu einen Kitt aussuchen,
der weich genug ist und sich später gut schleifen läßt.
Ich habe dafür einen speziellen Modellierkit der sich mit Wasser
glätten läßte. Diesen in kleinen Mengen mischen, zu einer
feinen 1-2mm starken Schnur rollen und abschnittsweise auf die
Schweißstelle drücken. Dann mit einem schmalen Spachtel oder
zahntechnischen Werkzeug andrücken, strukturieren und
glätten. Dazu das Glättwerkzeug gelegentlich in Wasser
tauchen.
Dieser
Arbeitsgang kann auch nachträglich noch über die bereits mit
Sekundenkleber gesetzten Schweißnähte gelegt werden, falls
sich diese nach der Grundierung als zu schwach
dimensioniert erweisen sollten. Auf dem opak-weißen
Untergrund ist ja die genaue Form der Nähte nur schwer erkennbar.
|
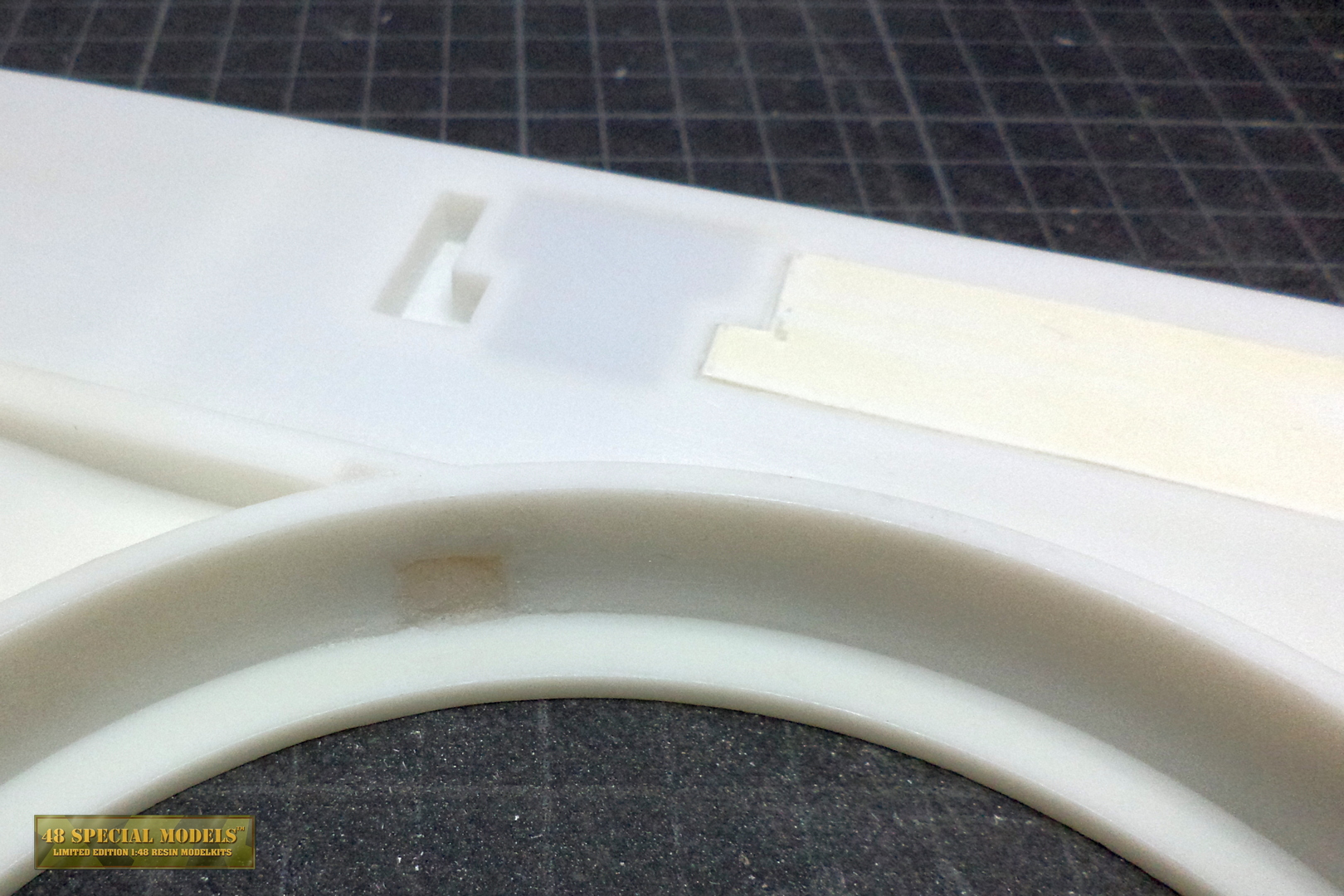 | 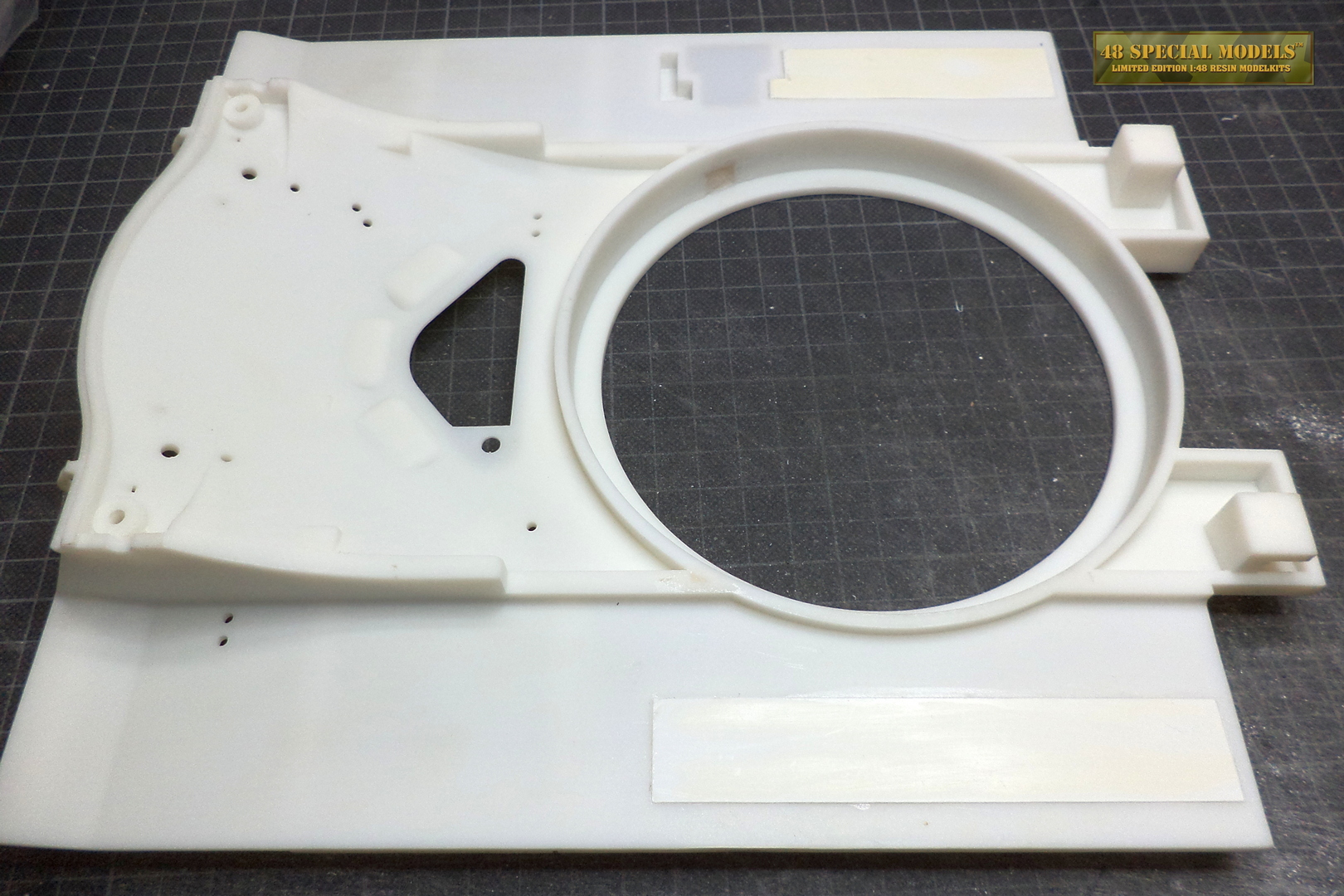 | | Die
Vertiefung links kann mit Epoxidkitt oder in diesem Fall mit
Sekundenkleber und Füllmittel verfüllt werden.
Anschließend wird alles plan geschliffen. | Die Innenseite der vorderen Oberwanne im Ganzen.
Beachte rechts die Einrastklauen zur Befestigung an der Unterwanne. | 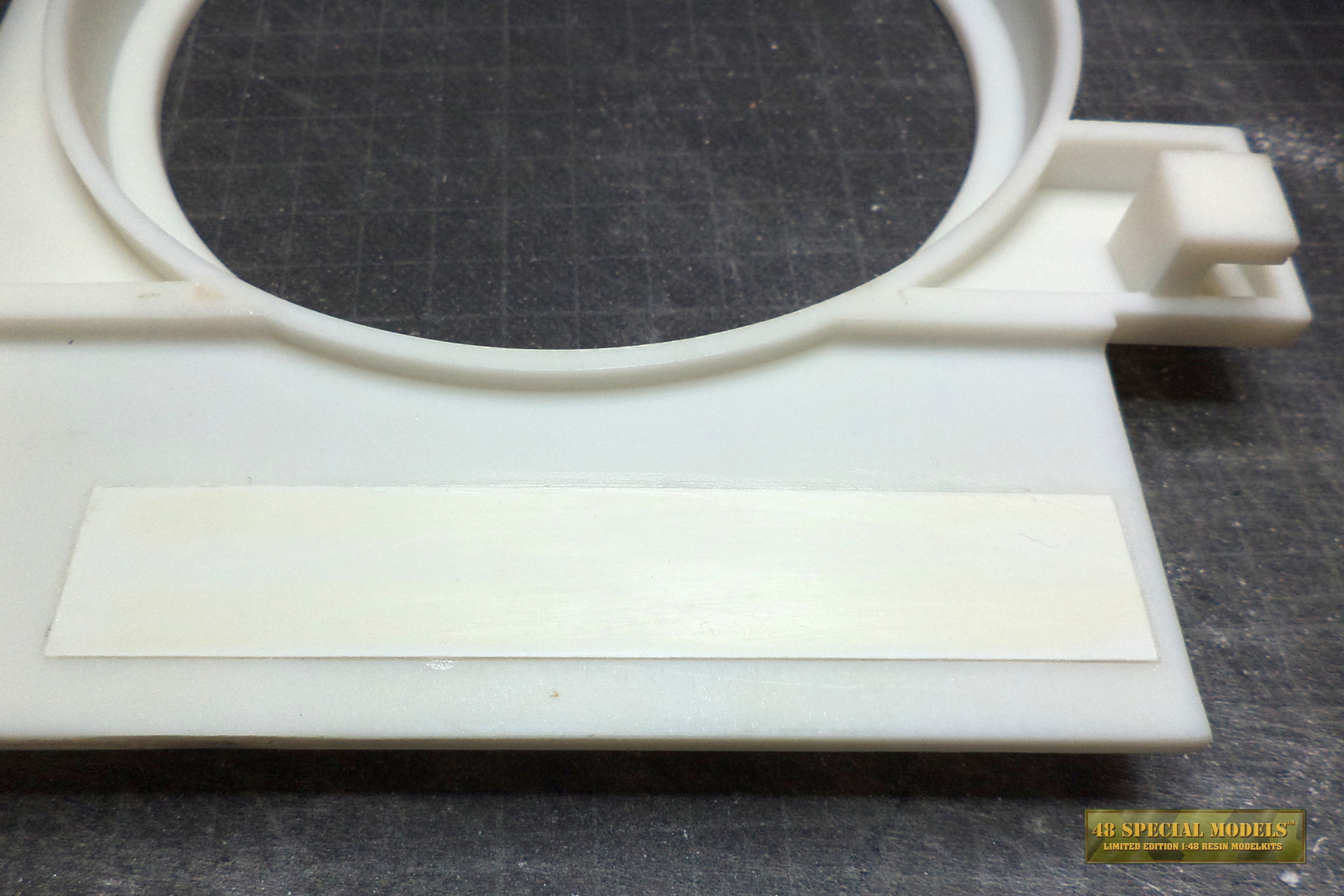 | 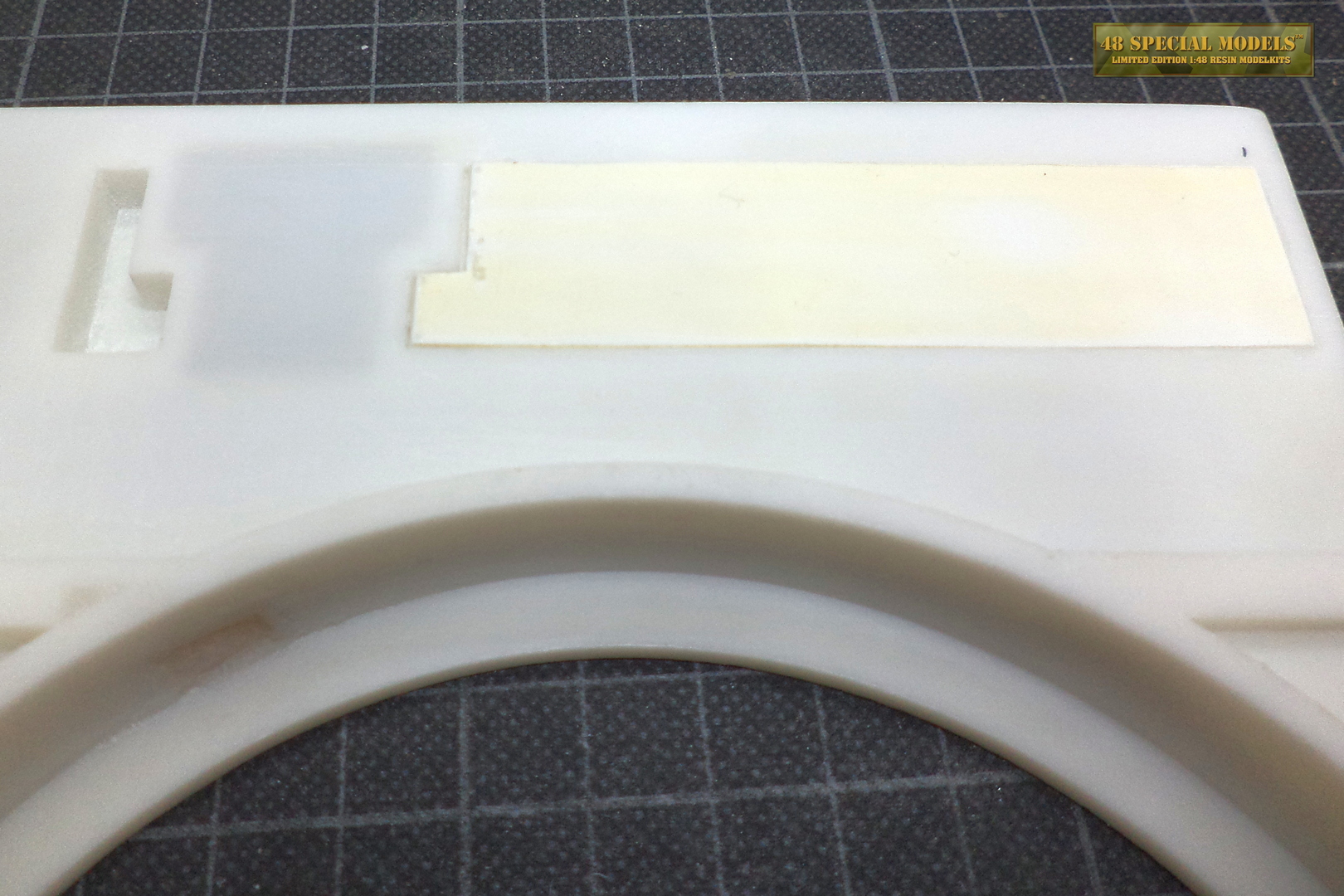 | | Nach
dem Verschließen muß noch der minimale
Höhenunterschied beigeschliffen werden, da die Platte
geringfügig dicker ist. | Auch hier wird noch nachgearbeitet,
sobald die linke Öffnung geschlossen ist. | 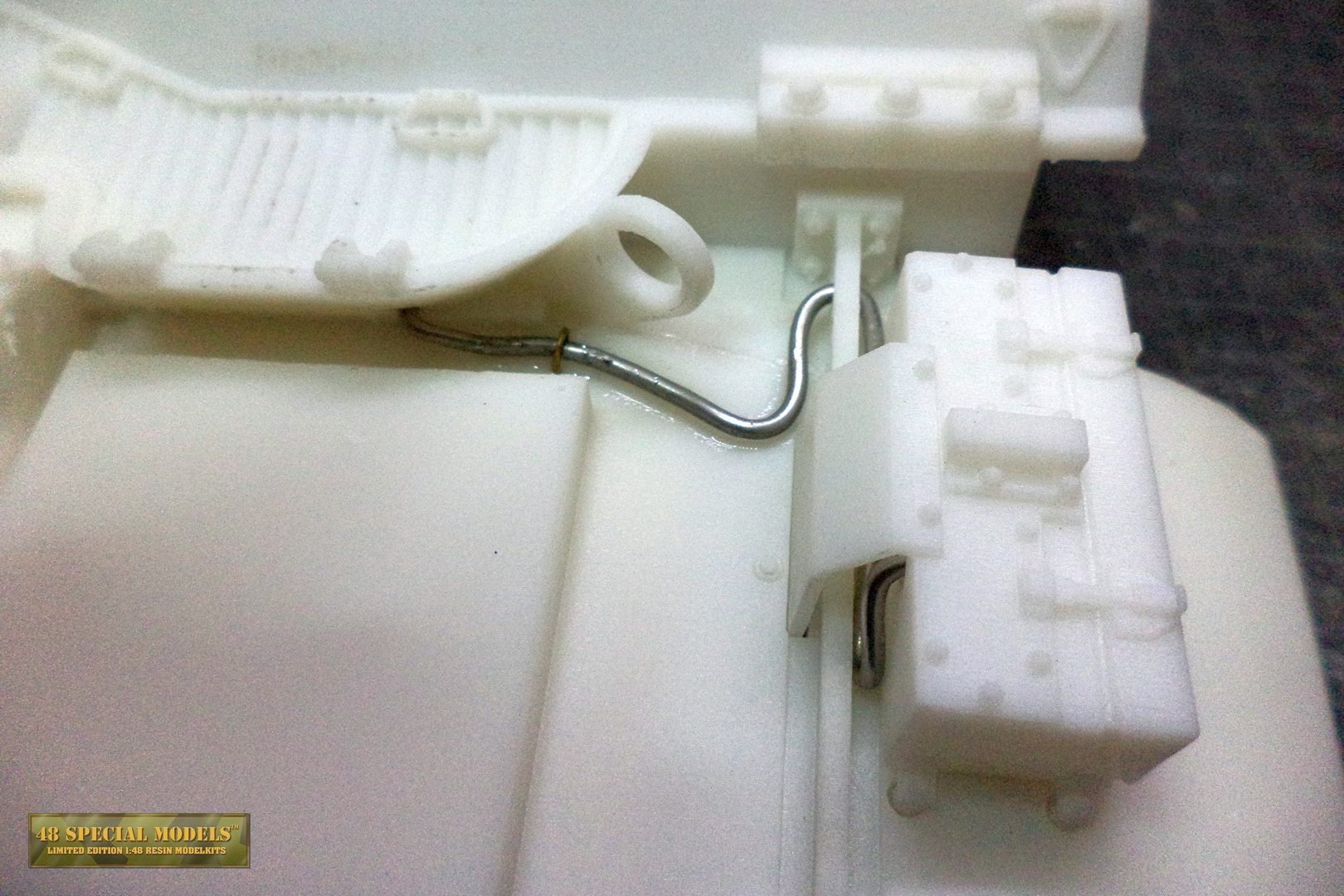 |  | | Kleines
aber wichtiges Detail am Heck. Die Box mit der Fernsprechereinheit
für die Infantrie sollte schon ans Fahrzeug angeschlossen werden! | Dazu
etwas Lötzinn mit 2mm Dicke passend zubiegen. Ins
Motorengehäuse an der richtigen Stelle ein passendes Loch bohren,
ebenso in die Rückwand der Box. | 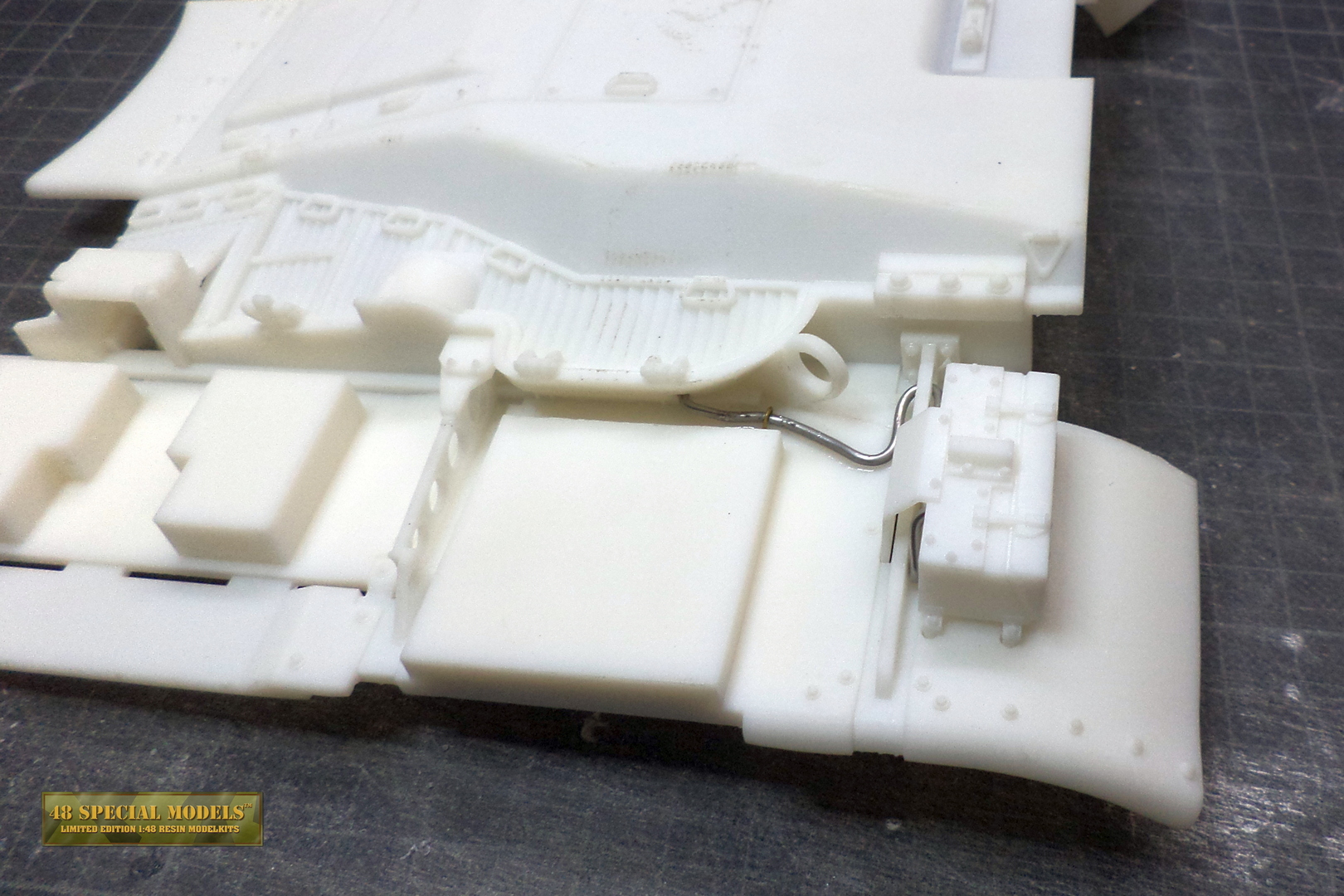 |  | | Um
das Kabel einzupassen muß es erst links in die Öffnung
gesteckt, dann durch die Haltestrebe gefädelt und
anschließend in Form gebogen werden. Ganz zum Schluß wird
es in die Box geführt, die aber noch nicht verklebt wurde! | Die
angeschweißten Streben werden mit Schweißnähten aus
dickflüssigem Sekundenkleber und Füllmittel erstellt.
Achtung, den Untergrung anschleifen für bessere Haftung! |  |  | | Diese
Methode wird an allen Schweißnähten wiederholt.
Anschließend werden in die beiden Antennensockel je ein 1mm Loch
so eingebohrt, daß das Regenwasser dadurch ablaufen kann. | Auch die Haken für die Kabelhalterung nicht vergessen! |  |  | Unter dem Turmheck befindet sich ein angeschweißter, gebogener Rundstab, der der Turmkante folgt.
Er ist bei fast allen Panzern der A2 Serie zu finden. | Sein Sinn ist mir nicht klar, aber er gehört eindeutig an den A2 Turm.
Hierzu
habe ich einen 1,5mm Messingdraht weichgeglüht, zurechtgebogen und dann
erst an einer Seite, dann der Mitte und anschließend der anderen
Seite mit einem Sekundenkleberpunkt fixiert. Danach wurde den gesammte
Draht entlang, beidseitig eine Klebstoff Linie gezogen und mit
Füllmittel abgestreut. |  |  | | Auch die Ösen vorne und hinten haben Schweißnähte. | Ebenso die Halter für den Scheinwerfer auf der Kanonenblende. | 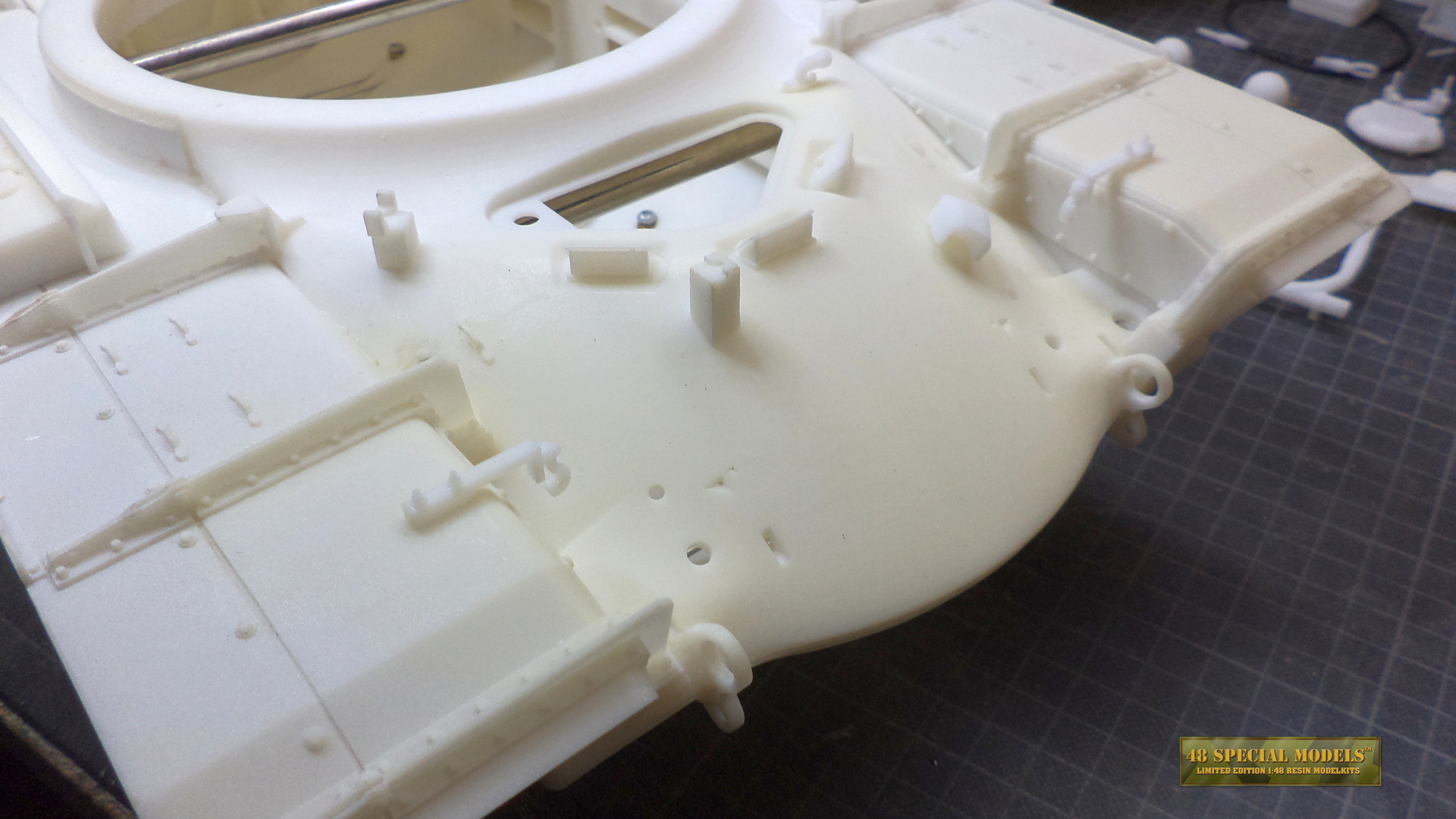 |  | Jetzt können die noch fehlenden Kleinteile montiert werden.
Dabei ist die Fotoreferenz unersetzlich. | Neben
die Lukenöffnung gehört das gebogenen Rohrflansch, dem
allerdings der Filterkopf fehlt (wie auf dem Foto) der aber im Einsatz
nötig war. |  | 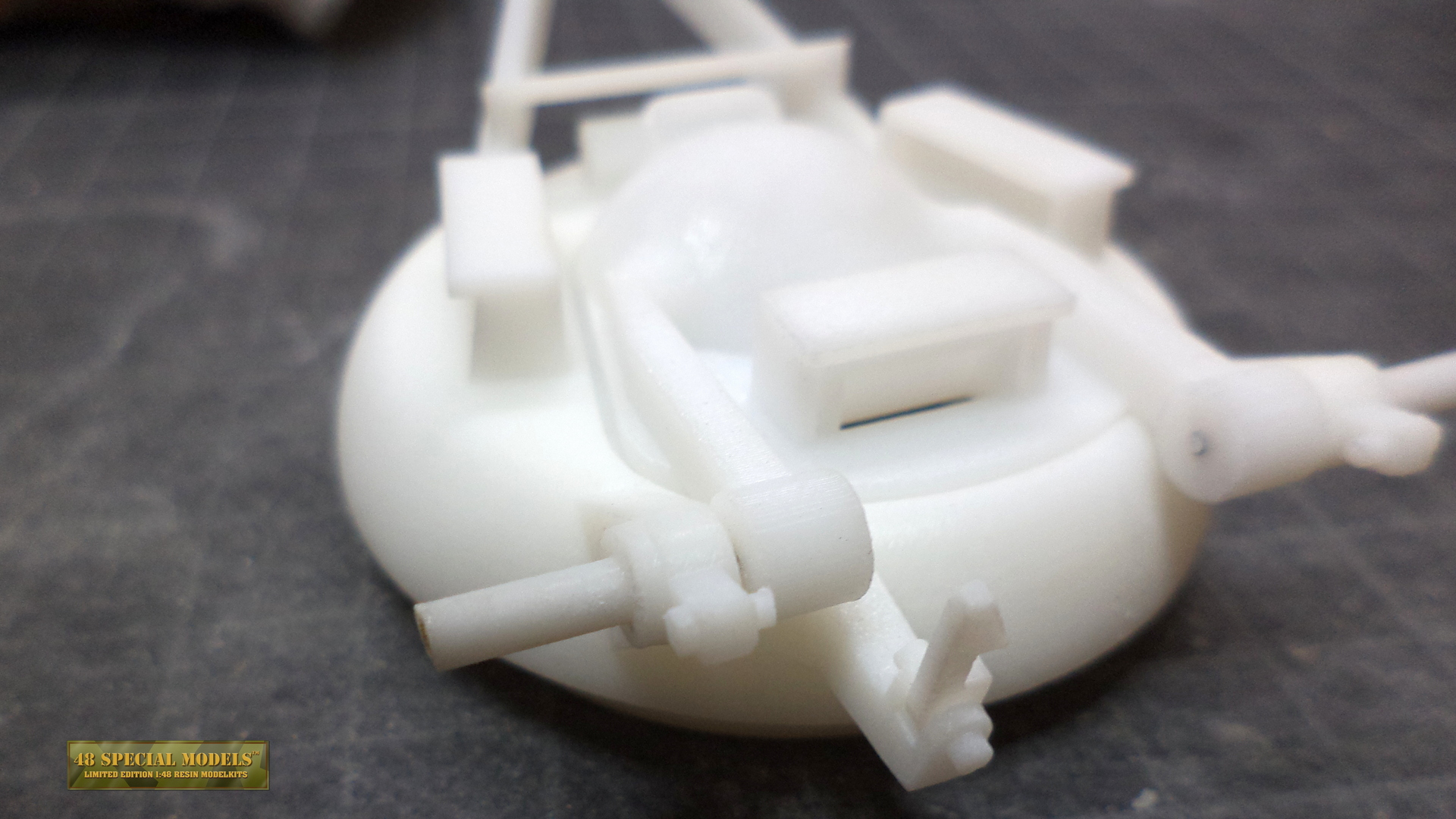 | | Der Tankverschluß sitzt rechts hinter dem Turm. | Die
Kommandantenluke wurde vom Hersteller schon mit einer Nadel als Achse
versehen und festgeklebt. Den Nadelkopf mußte ich, auf beiden
Seiten, mit der Minitrennscheiben noch entfernen. |
|
Die
Kettenbleche
Die
Kettenbleche haben auf der Oberseite Staukästen, Luftfilter und andere Kästen. Damit man diese gut
befestigen kann wurde vom Hersteller eine Art "Schattenkasten" erstellt,
der auf der Unterseite einen Hohlraum hinterläßt.
Offensichtlich sah man das als wenig tragisch an, denn es wäre
technisch problemlos möglich diesen Hohlraum in der Produktion
einfach zu zu drucken! Hier sind aber manchmal dem Hersteller die
klassische Beschränkung der Möglichkeiten in anderen
Fertigungsprozessen noch im Weg. Man denkt nicht daran, daß man im 3D
Druck alle Freiheiten hat, die einem in anderen Fertigungsprozessen
nicht gegeben sind. Das Drucken geschlossener, hohler Körper
eingeschlossen.
So muß ich mich auf die klassische Methode
besinnen und in die Vertiefungen Stützstreifen einpassen und eine
Platte darüber kleben, die dann sauber verschliffen wird, bis eine
ebene Fläche entsteht.
Das
ist zeitraubend aber nötig, denn die Öffnungen an der
Unterseite sind nicht nur falsch und unschön, sondern auch
Schmutzfänger. Also die Abdeckplatten genau anpassen, zuschneiden
und einkleben. Ich arbeite mich von hinten nach vorne durch, denn die
hintere Oberwanne ist etwas kleiner und nur mit Magneten befestigt.
Zudem hatte ich da den Transportschaden, der noch einer gewissen
Verstärkung bedarf.
Glücklicherweise hat der Hersteller
diesen Bereich um diese Vertiefungen ebenfalls etwas tiefer gesetzt. Bei
der hinteren Staukiste sind das fast 1,5mm, was eine stabile
Plattenstärke zuläßt. Glücklicherweise reicht
die Aussparung bis über die Bruchstelle hinweg, so daß eine
aufgeklebte Platte selbige recht gut verstärkt. Die Form ist etwas
anspruchsvoll, läßt sich aber relativ schnell herstellen und
da man sie zweimal braucht, geht die zweite mit Hilfe der Schablone
bedeutend schneller. Zur Wanne hin muß die Form genau passen,
ansonsten geht sie nicht mehr auf die Unterwanne. Also sauber arbeiten!
Der
längere, rechteckige Streifen ist nur 0,5mm stark, muß aber
nur die Hohlräume verschließen. Daher kann einfach ein
passendes Rechteck zugeschnitten und über die Öffnungen
geklebt werden. Es reicht aber bis über
die Lasche, die unter die vordere Oberwanne reicht und da das Teil
fixiert. Bei meinem Bruchschaden ist hier eine der Ecken
ausgebrochen, die nun nicht nur verstärkt, sondern auch wieder
hergestelllt werden muß.
In beiden Fällen langsam
härtenden Sekundenkleber benutzen, da dieser kleine Korrekturen
zuläßt. Mit Leimzwingen fixieren und gut trocknen lassen.
Anschließend vorsichtig beischleifen, bis eine durchgehende
Fläche entsteht.
Bei den vorderen, langen Staukästen
wird genauso verfahren. Nur das einer davon unterbrochen ist und dort
eine Vertiefung von oben her hat. Vermutlich ist das Teil von einem M60
Bausatz und wird hier zweitgenutzt. Ich konnte zwar nicht feststellen
was da beim M60 eingebaut ist, aber beim M103 ist der Kasten komplett
durchgängig. Glücklicherweise kann man die erhaben Seite von
der Unterseite her sauber plan schleifen, ohne daß die Fläche zu
dünn wird. Vorsichtshalber habe ich die Innenecken von der
Gegenseite her mit einer Klebstoffnaht gefüllt und so
verstärkt.
Die Staukästen sind hier, von unten
her gesehen, leider mit dem Kettenblech eben, so daß nicht einfach
eine Platte darüber geklebt werden kann. Man muß in die
Hohlräume Streifen aus Polystyrol einkleben, die um die
Plattenstärke, welche eingeklebt werden soll, niedriger sind als
die Umrandung. So bekommt man eine ebene Oberfläche und kann auf
vorhandenes Plattenmaterial einer beliebigen Stärke
zurückgreifen. Ich habe, der Einfachheit halber und weil es gut zu
schneiden ist, eine 1,5mm Platte zugerichtet und eingepasst.
Auf
der
anderen Seite fällt die Platte kürzer und mit einem
Eckausschnitt aus. Das daneben liegende kleine Loch fülle ich mit
Sekundenkleber und Füllstoff auf. Das geht schneller und ist nicht
soviel Fummelarbeit.
Bei den großen Öffnungen hätte man das natürlich
auch mit Epoxidkitt machen können, die Oberwanne hätte
dadurch aber auch
Gewicht zugelegt und je nach Material hätte man 24 Stunden warten
müssen bis man verschleifen kann.
|
Die Feldtelefonbox am Heck
Die
Feldtelefonbox am Heck war eine Verbindung nach außen, die sich
im Vietnamkrieg bewährt hat. Auf dem linken hinteren
Kettenschutzblech war eine Kiste montiert, die sich aufklappen
läßt und Zugang zu einem Feldfernsprechen und ausreichend
Kabel ermöglicht. Die ist mit dem Innenraum verbunden und
ermöglich die Kontaktaufnahme von Außen. So kann z. B. der
Kommandant von außen den Fahrer einweisen oder Feuerbefehle
erteilen. Ebenso kann die Infanterie, die den Panzer als Schutz nutzt,
gegebenenfalls auf Ziele hinweisen oder diese beschießen lassen.
Beim M103A2 wurde diese "Neuheit" verbaut aber nicht beim M1. Der bekam
dieses nette Gadget erst nach dem Golfkrieg und der Erkentniss das es so
manchem Soldaten das Leben hätte retten können im
Häuserkampf!
Die Box liegt dem Bausatz bei und ist
schön gedruckt, hat aber keinen Kabelanschluß ans Fahrzeug.
Denn mußte ich scratch bauen. Man benötigt einen 2mm Bohrer,
ein Stück 1,5-2mm dicken Lötzinndraht und ein kurzes
Stück 0,8mm dicken Messingdraht.
Mit dem Bohrer werden an der
linken Motorenverkleidung und der Boxrückseite (siehe Bild) je ein
Loch gebohrt. Der Lötdraht wird dann in das Loch am Motorraum
eingeführt und durch die Kettenblechhalterung geführt, dann
um 90° gebogen und hinter dem Halter zur Box geführt und dort
in das Loch eingeschoben. Das eine Ende am Motorraum wird
zusätzlich mit einer Kabelschelle befestigt. Diese wird aus
einem gebogenen 0,8mm Messingdraht gefertigt und durch zwei kleine
Löcher, durch das Kettenblech geführt und angeklebt. Die Box
wird erst später nach der Lackierung montiert, daher das andere
"Kabelende" noch nicht verkleben.
|
Die vordere Oberwanne
Nun
wird die vordere Oberwanne gewendet und sich der Oberseite zugewandt.
Auf den ersten Blick sieht alles toll aus. Beim Detailvergleich mit den
Fotos zeigen sich aber einige Unterschiede. Die langen Staukästen
sind zu schmal und hinterlassen nach dem Einbau eine zu breite
Lücke am Turm. Die Rundung am Turm hat in Fahrtrichtung links eine
rechteckige Öffnung, die es so nicht gibt. Stattdessen ist hier
beim Original ein rechteckiger Streifen angeschweißt, der um die
Rundung herum führt. Der Streifen ist eine Verstärkung und
Befestigung des Kettenblechs und auf den Fotos klar zu erkennen. Also
muß er nachgebaut werden!
Eine passende Plattenstärke
aussuchen, einen 9 mm Streifen von ca.70 mm Länge zuschneiden und
anpassen. Durch ziehen über einen runden Bastelmessergriff kann
der Streifen vorgerundet werden. Dann mit mittelviskosem Sekundenkleber
vollflächig verkleben. Dabei darauf achten, daß Teil auf anhieb
korrekt zu plazieren, denn der Kleber hält sofort. Wem das zu
gefährlich ist, der kann auch dickflüssigen, langsam
trocknenden Sekundenkleber nehmen, muß diesen aber entsprechend
dünn auftragen!
Das Teil mit Leimzwingen
fixieren und antrocknen lassen. Dann die Zwingen entfernen und mit der
Kanüle mittelviskosen Sekundenkleber auf die Plattenkanten auftragen und
anschließend mit Füllmittel abpudern. Den
Überschuß gleich abschütteln und wegblasen. So zeigen
sich eventuelle Fehlstellen die man gleich nacharbeiten kann. Ist die
Naht zufriedenstellend, gut trocknen lassen.
Beim Vergleich mit
den Fotos fällt auch auf, daß die Kante vor dem
angeschweißten Blechteil bedeutend stärker und anders
abgerundet ist als am Modell. Hier ist eine harte grade Abbruchkante an der Frontschräge zu
sehen, die es auf den Fotos nicht gibt. Daher muß diese Rundung
mittels Feile und Schleifpapier angepasst werden. Der Einsatz des
Kleinbohrers mit Schleif- oder Fräskopf sollte sehr vorsichtiog
passieren, sonst hat man schnell ein Loch im Deck.
Apropos
Loch. Die rechteckige Aussparung am Turmrand wurde ja mit dem Blech
weitgehendst zugeklebt. Auf der Innenseite klafft aber noch ein relativ
großes Loch und die Eckbereiche sind auch sehr dünn.
Daher dickflüssigen SK, in dünnen Schichten, zuerst in die
Ecken geben, dann eine Lage Füllmittel darüber streuen.
Abschütteln des Überschußes und das ganze solange
wiederholen, bis das Loch ausreichend gefüllt ist. Alternativ,
wenn vorhanden, kann stattdessen auch Epoxidkitt verwendet werden.
Die
Staukästen auf der Oberseite werden übrigens erst lackiert
und dann aufgeklebt. Da es sonst Hinterschneidungen gibt, die mit der
Sprühdose nur schwer zu lackieren sind.
Sind
alle Änderungen erfolgt und alle Schweißnähte gesetzt,
werden noch die Kleinteile auf die Frontseite geklebt. Dazu
gehören der gekrümmte Flansch neben der Fahrerluke rechts,
die Haltebügel mit Schraubschelle an den Kettenblechen rechts und
links und der kleine Kasten mit den Feuerlöscherauslösern für den Motorraum.
Noch
ein Hinweis: Die Rödelriemenösen die auf dem ganzen Modell so
wunderbar vorbildgetreu mit aufgedruckt wurden, haben innen,
druckbedingt, eine Stützstruktur. Diese sollte man besser nicht
entfernen, denn in den meisten Fällen entfernt man damit auch die
Öse. Das ist mir passiert und ich mußte die Öse dann
mit Messingdraht rekonstruieren. Wo man die Rödelösen nicht
richtig benötigt, sollte man sie daher lassen wie sie sind. An
Stellen an denen Gurt durchgeführt werden müssen, muß
man sie eventuell durch Messingdraht ersetzen.
|
Das Turmheck
Am
Turmheck sind neben den Schweißnähten auch einige kleine
Umbauten nötig. Kaum zu erkennen und nur an den Spuren die sie
Hinterlassen, sind die Bohrungen über die das Regenwasser aus den
Antennenhaltersockeln abläuft. Hier führt von oben nach
hinten außen eine Bohrung mit leichter Schrägung das
Stauwasser ab, das sich im Antennensockel sammelt. Am Modell fehlt
dieses feine aber wichtige Detail. Und mit einem 1mm Bohrer und nur je
einer Bohrung an diesen beiden Antennenhaltersockeln tritt man völlig unvermittelt dem Nietenzähler Club bei!
An
der hinteren, unteren Turmkante verläuft ein angeschweißter
Rundstab entlang. Vermutlich soll er Regenwasser
ableiten. Nach dem ich erst dachte es gäbe dieses Teil nur an den
"Denkmälern" mußte ich feststellen, als ich alle mir
greifbaren Bilder der A2 Versionen durchsah, daß es sich um ein
A2 typisches Standardelement handelt. Alle Fahrzeuge hatten es.
Daher
nahm ich mir einen 1,5mm Messingdraht, glühte ihn weich, bog ihn
der Rundung entsprechend und klebte ihn erst mit Punktverklebung und
dann vollflächig an die Turmkante. Die Klebenaht wurde mit
Füllmittel abgestreut und so zur Schweißnaht. Fertig!
|
Grundieren des Modells
Bevor
ich mit den anderen Detailarbeiten weitermachen kann, brauche ich erst
einmal einen Überblick über die bereits getätigten
Feinheiten. Da das opake Weiß einen fast Blind macht, habe ich
mich entschlossen zuerst eine graue Grundierung aufzutragen. Aber davor
muß das Modell erst einmal richtig vorbereitet werden.
Da
es sich beim Material zwar um einen Kunststoff der thermoplastischen
Art handelt, dieser aber nicht mit Polystyrol oder ABS vergleichbar
ist, sondern mehr Richtung Polyethylen tendiert, muß das ganze
Modell gut vorbereitet sein.
Zuerst reinige ich alles mit
Silikonentferner. Der entfernt neben Silikon, wie der Name schon sagt,
aber auch Fett oder andere Rückstände wie Staub. Da das
Modell, besonders die Wanne recht groß ist, habe ich mir dazu
eine Pflanzschale, wie man sie zum Gärtnern nutzt besorgt. Diese
besteht aus einer tiefgezogegen, rechteckigen Wanne und einer
abnehmbaren Ablageschale. Das Material ist
Lösemittelbeständig und kann daher auch als Waschwanne
für Waschbenzin oder andere Lösemittel genutzt werden, die
nicht in die Kanalisation gelangen dürfen. Man kann alles was
daneben geht bequem in ein passendes Gefäß umgießen
und die Wanne auch mit Lösemittel reinigen.
Nachdem die
Silikonentfernerwäsche erfolgt ist, nehme ich möglichst viel
davon mit weichen Papiertüchern auf und lasse den Rest grundlich
ablüften. Die Tücher gehören in den Sondermüll wie
alle Lacke!
Währendessen baue ich mir, aus alten Kartons, eine
provisorische Lackierablage im Freien. Da meine Lackierkabine dafür
zu klein ist und ich mit Spraydosenlack arbeite, ist der Weg an die
frische Luft am einfachsten. Dennoch sollte man auch hier eine Maske
mit Filter gegen organische Lösemittel tragen, denn die
professionellen Autolacke beinhalten heftiger Lösemittel als der
gewöhnliche Modellbaulack.
Vor dem eigentlichen
Farbauftrag kommt erst ein sogenannter Kunststoff Haftvermittler zum
Einsatz, den man benötigt um eine stabile Verbindung zwischen
Untergrund und Grundierung herzustellen. Dieser Haftvermittler
wird z.B. zur Lackierung von Kunststoffstoßstangen genutzt, da es
sich hier auch um einen schwer zu lackierenden Kunststoff handelt.
Das gereinigte Modellteil sollte man nach der Reinigung nur noch mit Handschuhen anfassen, die garantiert sauber sind!
Den
Haftvermittler, gemäß den Angaben des Herstellers, wie einen
Spraylack auftragen. Dabei darauf achten, das auch Hinterschneidungen
und Ecken und Winkel davon erreicht werden. Gut trocknen lassen und
derweil die graue Grundierung aufschütteln. Das ist wichtig, da
sich die Fillerpigmente schnell am Dosenboden absetzten und erst nach
mindestens 1 Minute schütteln wieder gleichmäßig im
Lack verteilt sind!
Nun kann der Tanz beginnen. Die
Ablagefläche auf der das Bauteil später trocknen soll
vorbereiten und dann das Bauteil gründlich von allen Seiten
grundieren. Man kann das Teil dabei in der behandschuhten Hand halten,
um so besser an versteckte Stellen zu gelangen, sollte aber schon
vorher festlegen wie man das Teil dann zum Trocknen ablegen kann,
ansonsten muß man es nämlich in der Hand halten bis es
trocken ist!
Von innen nach außen lackieren! Dabei
kontrollieren ob alle Bereich gleichmäßig lackiert werden.
Es empfiehlt sich erst die Innenseite zu lackieren, dann trocknen zu
lassen und anschließend die Außenseite. Meist kann man
nahtlos mit dem nächsten Teil weiter machen, während das
erste Teil trocknet.
Anschließend alles über Nacht durchtrocknen lassen.
Am
nächsten Tag wir die Lackierung geprüft und alle Stellen, die
noch nachgearbeitet werden müssen, werden abgearbeitet. Vorher kann man
noch alle Kleinteile grundieren, damit sie während dessen trocknen
können.
|
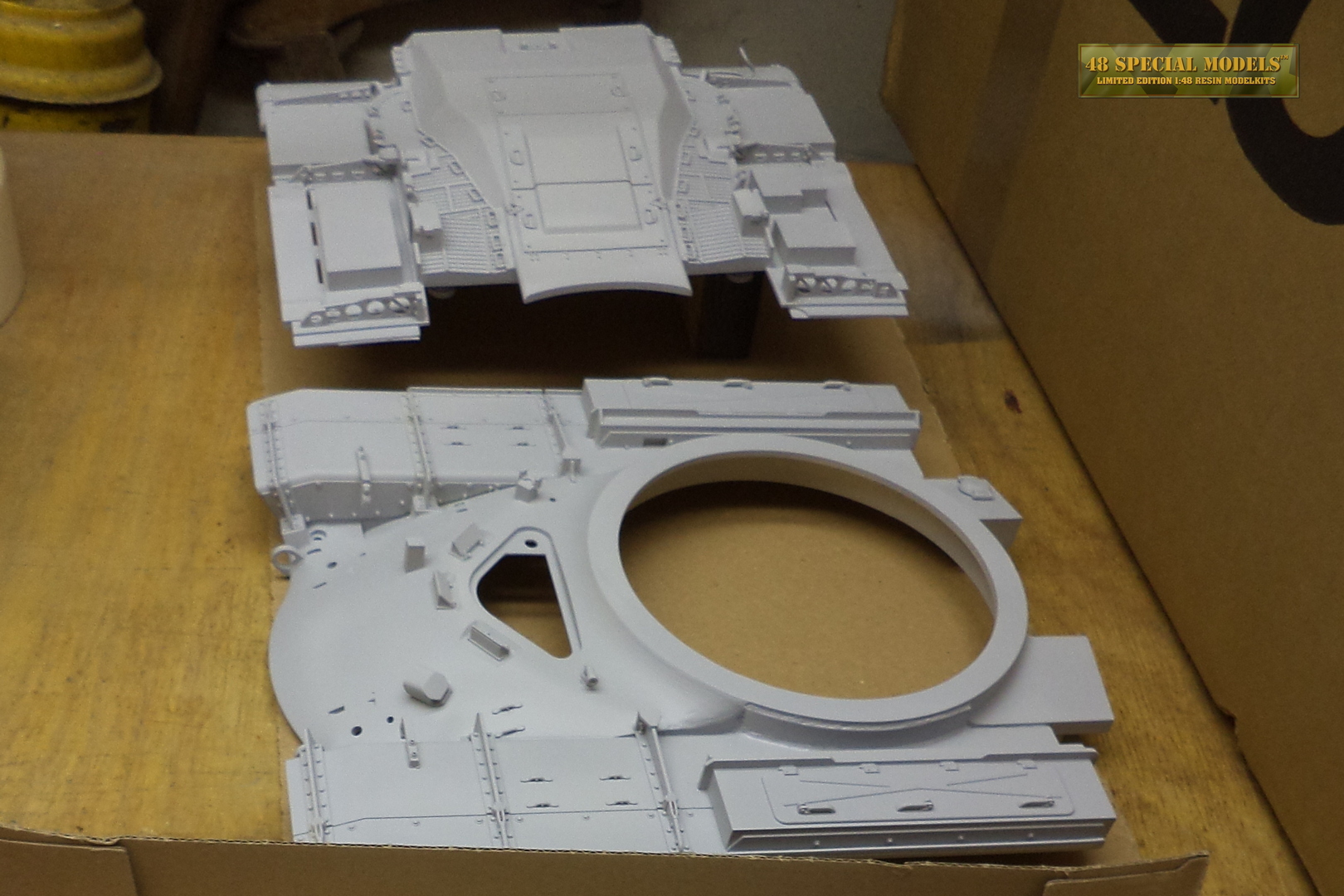 | 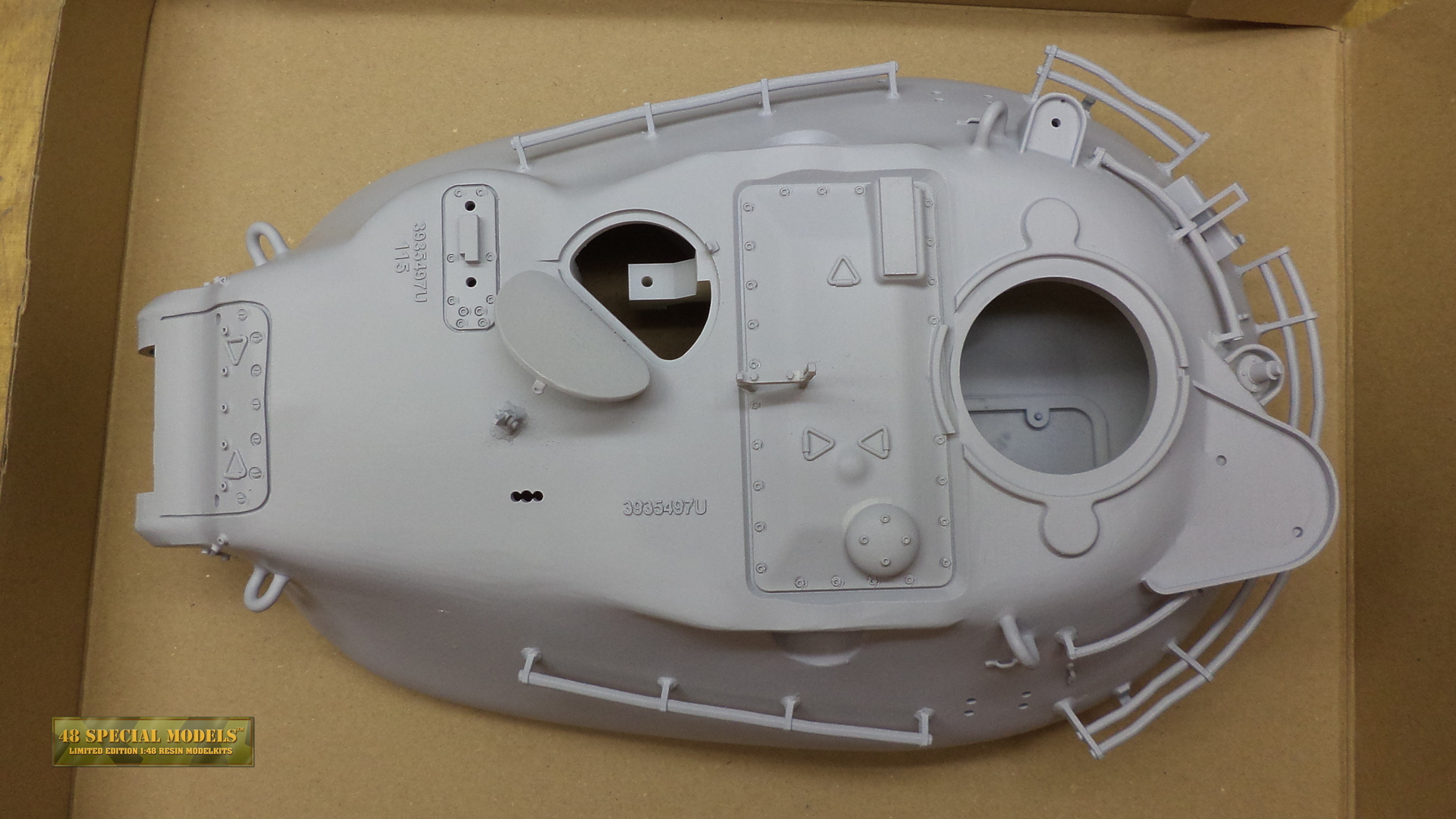 | | Vordere und hintere Oberwanne. | Der Turm von oben.
Jetzt kommen alle Details erst richtig zur Geltung. | 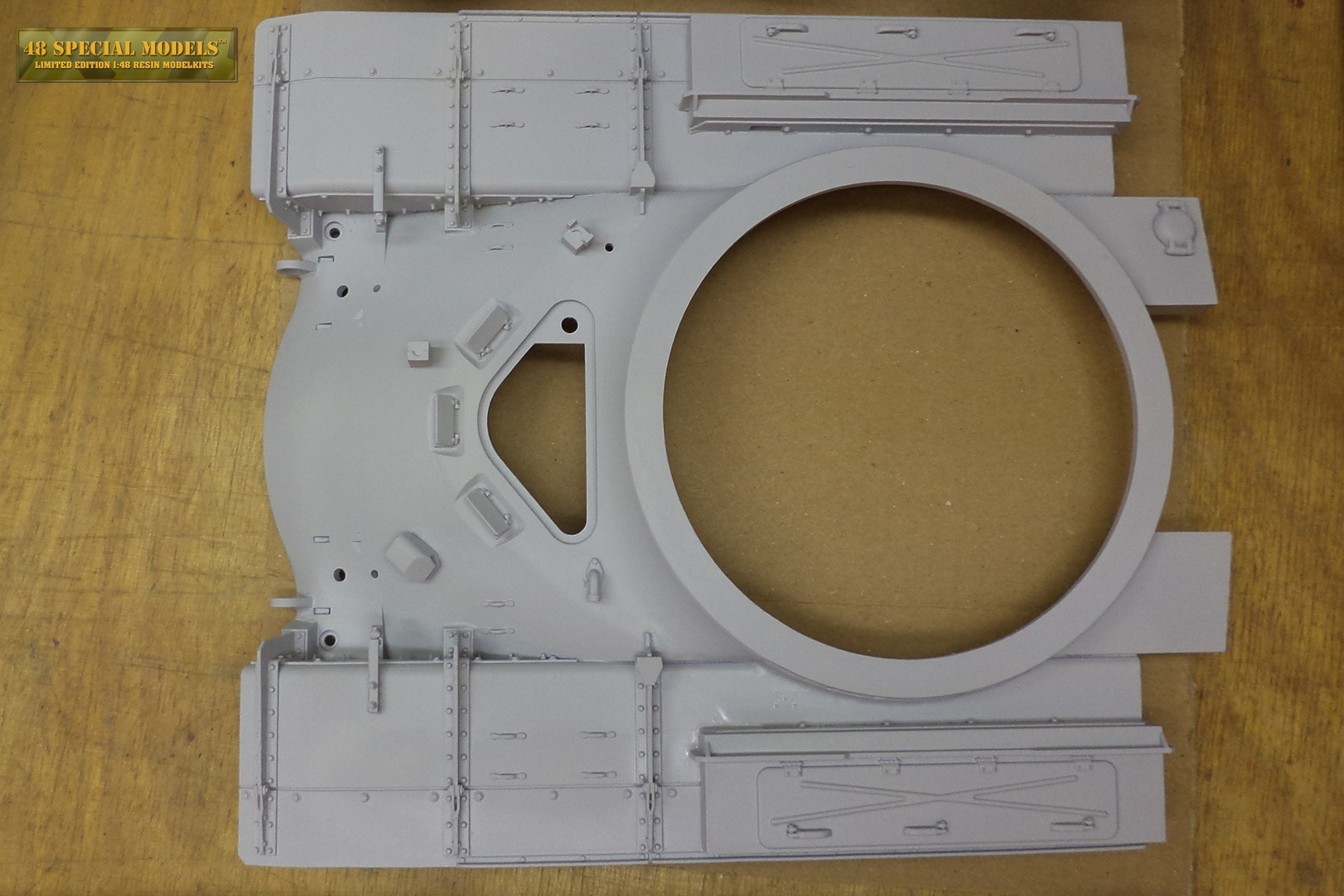 |  | | Auf der Oberwanne fehlen noch die Beleuchtung und die Fahrerluke, sowie das Abluftrohr rechts. | Die hinteren Staukästen und Auspufffilter, sowie die Feldtelefonbox werden getrennt lackiert. |  |  | | Wanne
und Schwingarme waren vormontiert und um Lackablagerungen an
Reibungspunkten zu vermeiden habe ich sie im Stück lackiert. | An
diesem Schekel sieht man die Spuren des Druckers in Form von Linien an
der Oberfläche. Diese müssen vor dem Lackieren egalisiert
werden, also schleifen! |
|
Die Lackierung
Nach
dem Grundieren erfolgt die Grundlackierung. Da in zerlegtem Zustand die
meisten Teile erheblich einfacher zu lackieren sind, wird die Hauptfarbe
Olivgrün zuerst flächendeckend lackiert. Das Modell soll
später im MASSTER Tarnschema erstrahlen und daher wird eine Farbe
aus diesem Schema die Grundfarbe. Generell waren die meisten Fahrzeuge
werkseitig olivgrün lackiert, bevor die MASSTER Tarnung eingeführt wurde.
Daher sieht man häufig Bilder in denen z.B. ein M60 A1 eine
getarnte Oberwanne und ein einfarbig olivgrünes Fahrwerk hatte.
Gründe dafür können sein, daß man mit dem Anstrich noch
nicht fertig war als das Bild gemacht wurde oder aber das man sich die
Arbeit sparen wollte im strukturierten Fahrwerk lackieren zu
müssen. Der MASSTER Anstrich war sowieso eine Art
Grundempfehlung wie die Farbgebung erfolgen sollte und wurde in
fast allen Einheiten sehr individuell ausgelegt!
Leider konnte ich
bisher keine Bilder eines M103 in diesem Anstrich finden, obwohl diese
Fahrzeuge, zur Zeit in der der Anstrich aktuell war, noch in Europa im
Einsatz waren. Allerdings gab es nur wenige von ihnen und daher ist
bisher wohl kein Bild in dieser Farbgebung aufgetaucht. Sollte jemand
eines haben würde ich mich freuen wenn er es mir zukommen
läßt, danke.
Der olivgrüne Anstrich kommt auch
aus der Spraydose. Es ist ein RAL 6003 gelbolivgrün, wie es auch bei der
BW verwendet wurde und in den späten 1980ern als allgemeine
Grundfarbe für alle US Neufahrzeuge genutzt wurde. Man erkannte
neu eingetroffenes Gerät immer an dieser Farbgebung, die vor
Ort dann mit individuellen Tarnschemen erweitert wurde.
Die
graue Grundierung sollte vor den erneuten Farbauftrag erst einmal
gereinigt werden. Es hilft auch mit einem Schleiffvlies vorher noch
Unebenheiten zu beseitigen und alles mit Silikonreiniger abzuwischen.
Nach dem die Oberfläche getrocknet ist, wird der grüne Farbton
in gleicher Manier wie vorher die graue Grundierung aufgetragen. Man
sollte an Vertiefungen und Hinterschneidungen anfangen, diese leicht
antrocknen lassen und dann flächig weiterlackieren.
Zwischenzeitliche kurzes trocknen hilft Farbnasen zu vermeiden! Immer
daran denken den Sprühstrahl in Bewegung zu halten, damit sich
keine Farbflecken ausbilden. Dünn und gleichmäßig ist
die Devise!
|
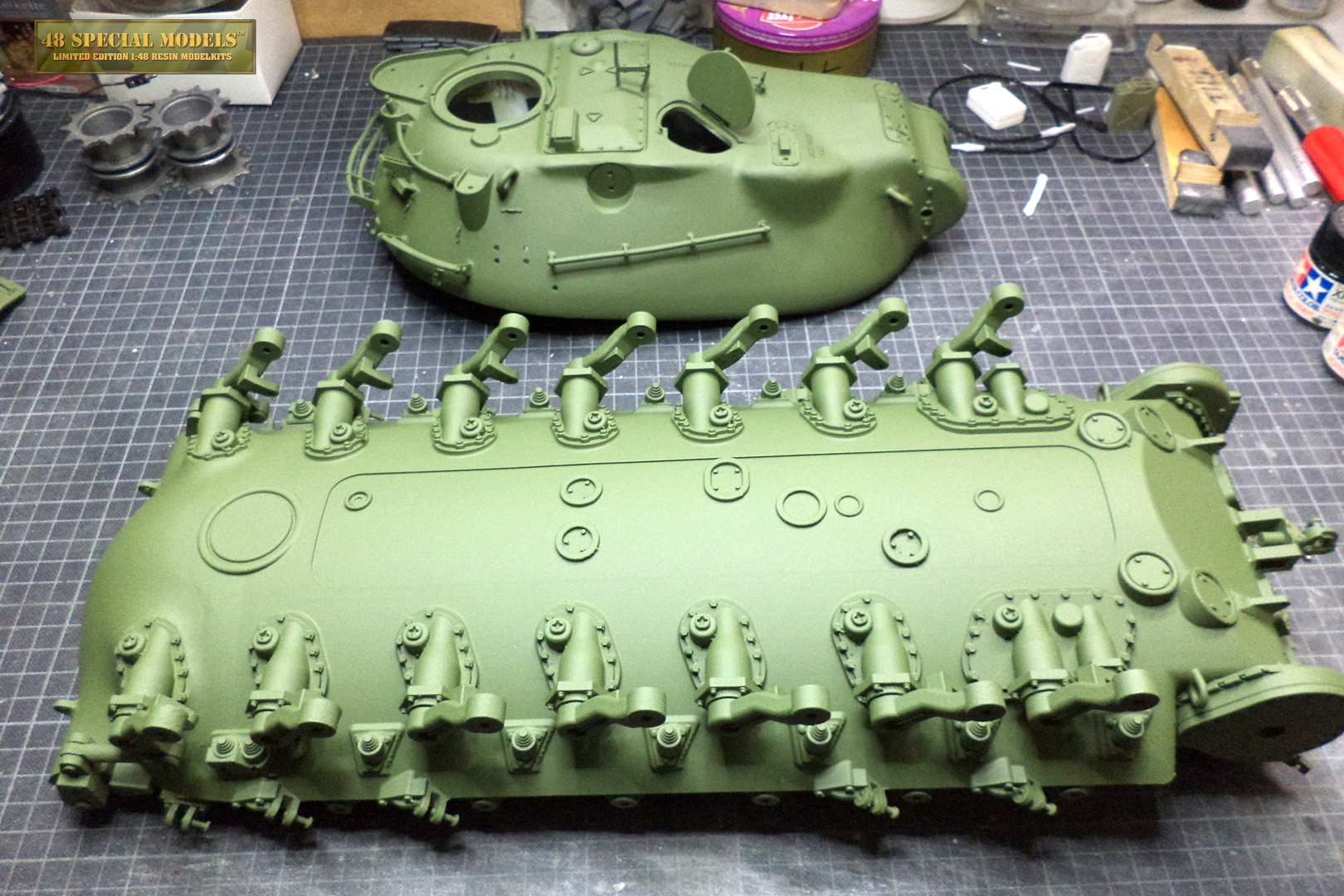 |  | | Was die richtige Farbe doch gleich ausmacht! | Der Turm von oben ohne Anbauteile.
Unter der Ladeschützenluke wird der IR-Sensor verbaut. | 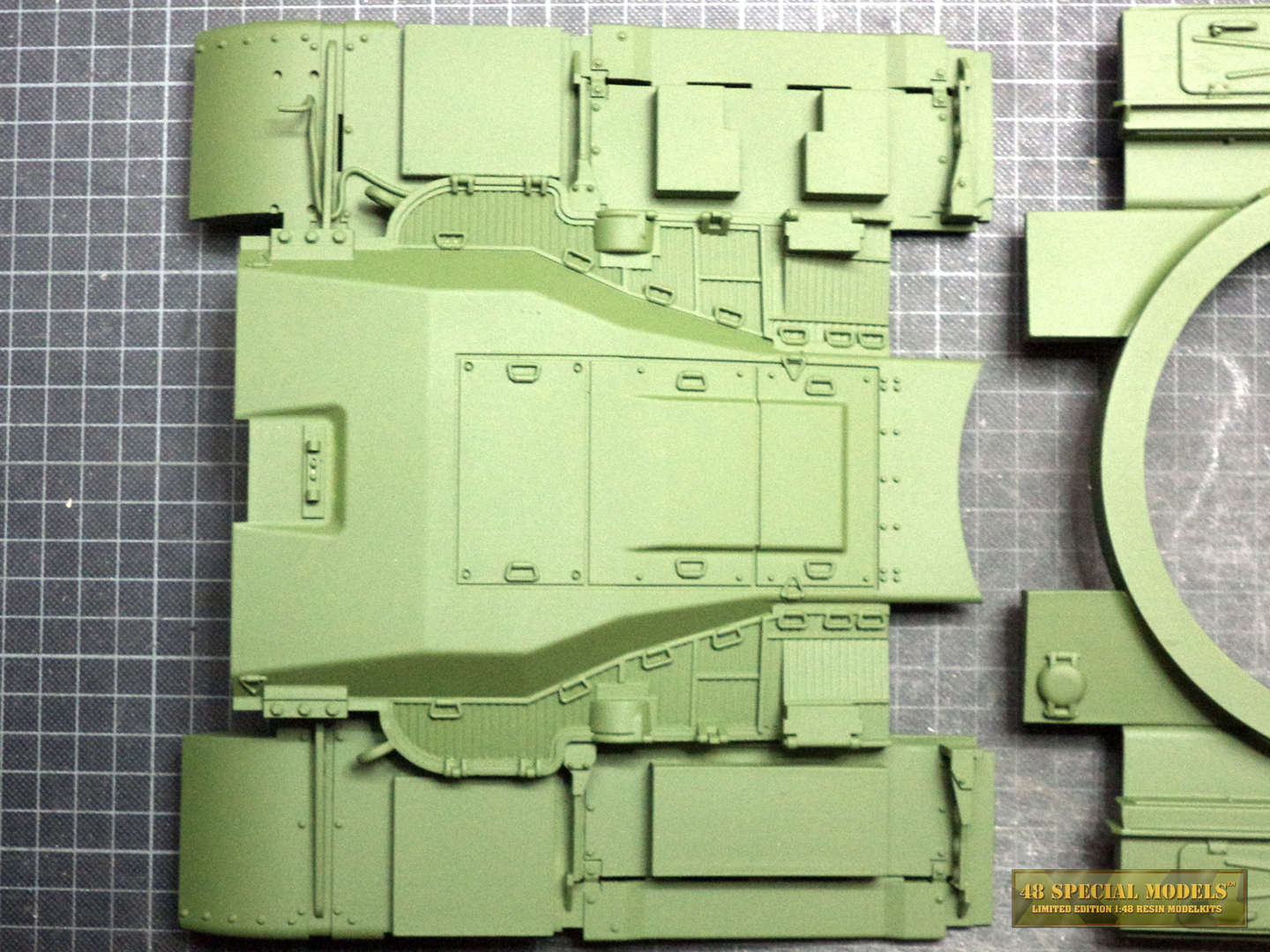 | 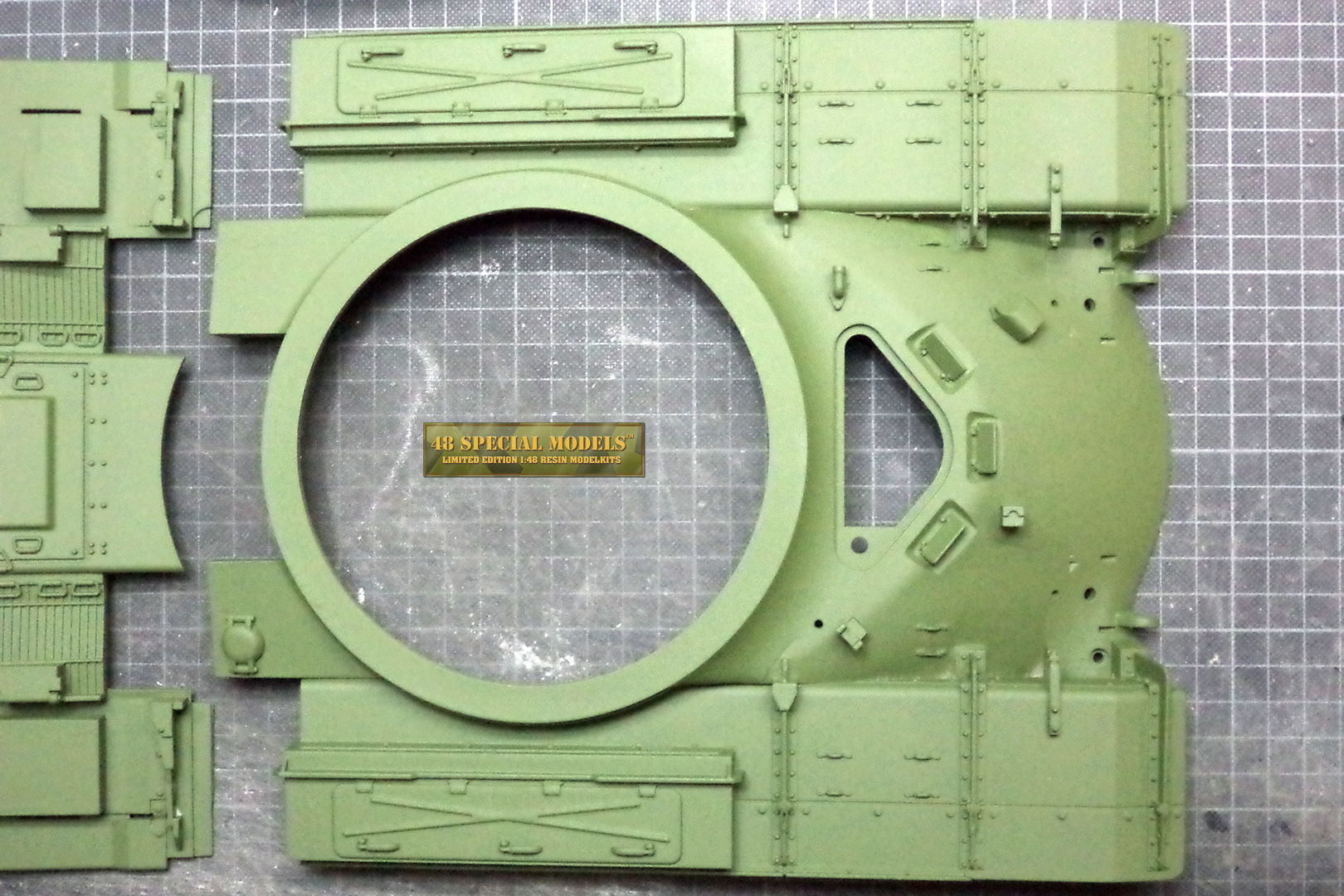 | | Auf der hinteren Oberwanne sind die Staukästen, etc. noch nicht installiert. | Vorne fehlt noch die Beleuchtung und die Luke. |  | 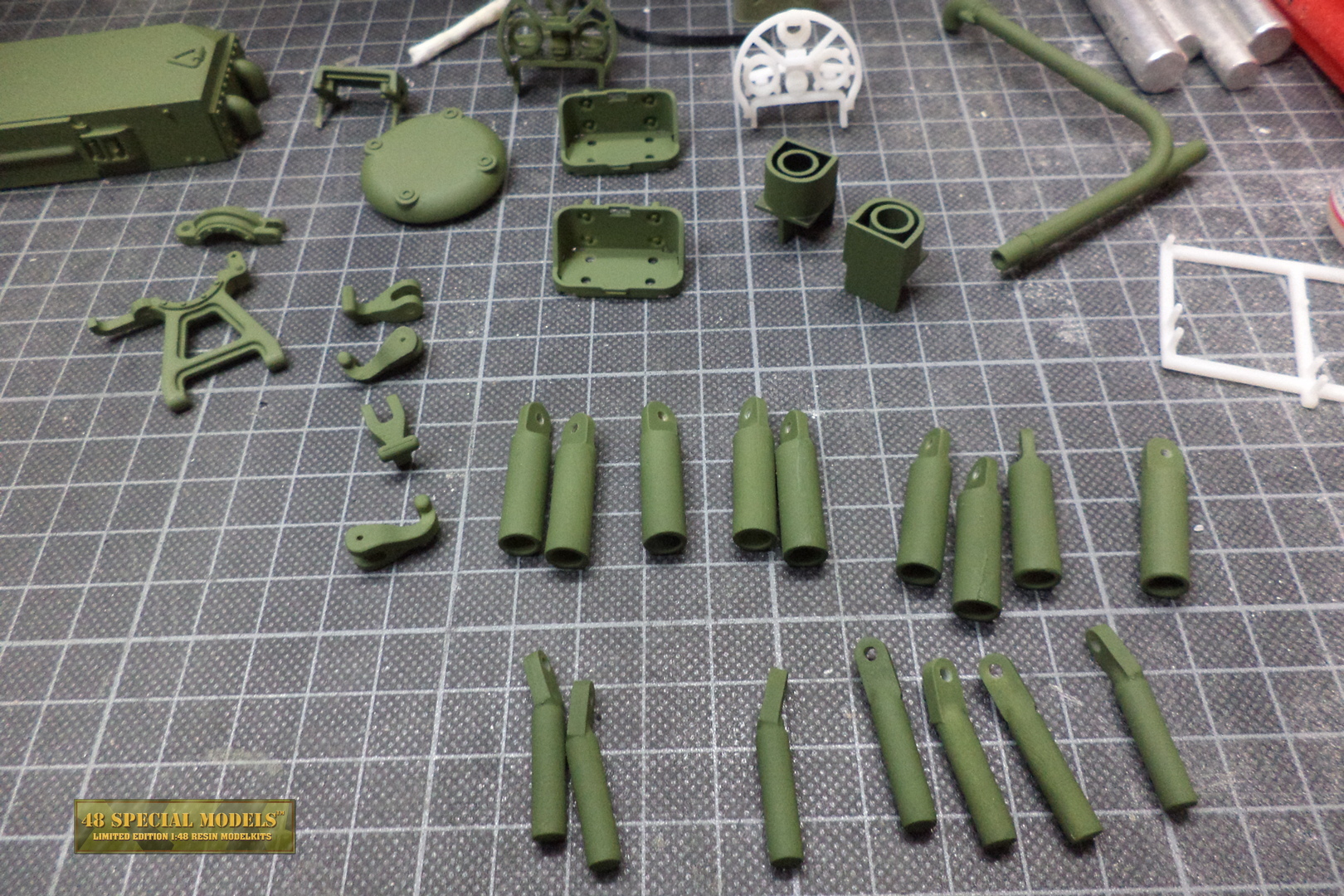 | | Kleinteile lassen sich einfacher lackieren, wenn man sie z.B. auf Schaschlikspieße steckt. | Alle Kleinteile wurden nur mit Kunststoffhaftgrund und olivgrünem Lack lackiert, da der Farbauftrag sonst zu dick wird. |
Nach den Hauptkomponenten geht es mit allen Kleinteilen weiter.
Manche
Kleinteile mit der Spraydose zu lackieren ist eine Herausforderung.
Seit Jahren, auch bei der Lackierung mit der Airbrush, hat sich der
Schaschlikspieß-Trick bewährt. Voraussetzung dafür ist
ein ausreichend großes Loch im jeweiligen Bauteil. Vorzugsweise
Bohrlöcher für Schrauben sind dafür geeignet, da sie
meist sowieso nicht voll Lack laufen sollen. Das Bauteil mit dem
Loch auf die Spitze des Spießes schieben und vorsichtig
festdrücken. Bei größeren Löchern hilft
Küchenkrepp, das um den Stab gewickelt wird, den Durchmesser zu
vergrößern.
Komplizierte Teile wie z.B. die
Kommandantenkuppel, die beim Lackieren auch gedreht werden müssen,
werden auf zwei oder mehr Spieße gesteckt.
Dann die Teile
einzeln mit der Spraydose besprühen. Dabei auf kurze
Sprühstöße achten und eine spuckende Düse
vermeiden. Anschließend die Spieße in einen Halter stellen,
z.B. einen großen Becher oder mehrere Rollen Klebeband und
trocknen lassen.
Gegebenenfalls muß nachlackiert werden, wenn nicht alle Seiten gleichmäßig mit Farbe bedeckt sind.
|
Fahrwerk und Laufrollen
Da
mir die mitgelieferten Kunststoffrollen und Antriebszahnräder
etwas schwach dimensioniert erscheinen und dem Fahrzeug noch Gewicht
fehlt, habe ich mir die Metallausgabe selbiger Räder besorgt.
Die
Laufrollen entsprechen denen des M26 Pershing und sind die gleichen wie
auf der gesamten M60 Serie, zu der auch der M103 gehört. Der M103
hat allerdings eine Laufrolle und eine Stützrolle mehr!
Das
Antriebszahnrad stammt bei diesem Modell vom M1A1, der eine
Weiterentwicklung des M103 Fahrwerkes darstellt. Da die Kette breiter
als beim M26 Pershing ist, muß ein passendes Antriebszahnrad
genutzt werden. Glücklicherweise sind die Amerikaner beim
Entwickeln neuer Laufrollen und Zahnräder recht faul und haben vom
M26 bis zum M60 fast die gleichen Laufrollen und Antriebszahnräder
verwendet.
Hinweis:
Ab April 2023 gibt es auch ein M60 Modell in 1/16 der günstigen
Art, das zwar viele Details vermissen läßt, für das es
aber auch Metalllaufrollen und Ketten gibt! In wieweit diese kompatibel
sind habe ich noch nicht klären können, aber sie werden auch
bei
https://www.dklmrc.com
angeboten. Nachfragen könnte sich also lohnen!
Beim M60 und M103 sind die Zahnräder, im
äußeren Teil, an drei Stellen, mit einer ovalen Öffnung
durchbrochen. Diese fehlt bei den Modellrädern, auch beim M1, da
das Material vermutlich zu schwach würde und der Formenbau
komplizierter. Man kann sich diese Ovale nachträglich
einfräsen, sofern man eine passende Maschine mit
dazugehöriger Spannvorrichtung besitzt. Man kann es aber auch
lassen. Ich habe zwar eine Kleindrehbank und könnte die Ovale
ausfräsen, habe mich aber, der Stabilität wegen, dagegen
entschieden.
 | | | Als erstes kommen die Gummireifen von den Laufrollen. |
|  |  | | Dann wird alles gründlich mit Silikonentferner entfettet. | Keine
Frage, das war sicher nötig! Das die Flüssigkeit vorher
wasserklar war brauche ich nicht extra zu erwähnen, oder? |  |  | | Fast alle Kleinteile sind nun einfarbig Olivgrün RAL 6003 lackiert. | Die Radnabe innen wird mit Nitroverdünner und
einem Wattestäbchen von Farbe befreit. | 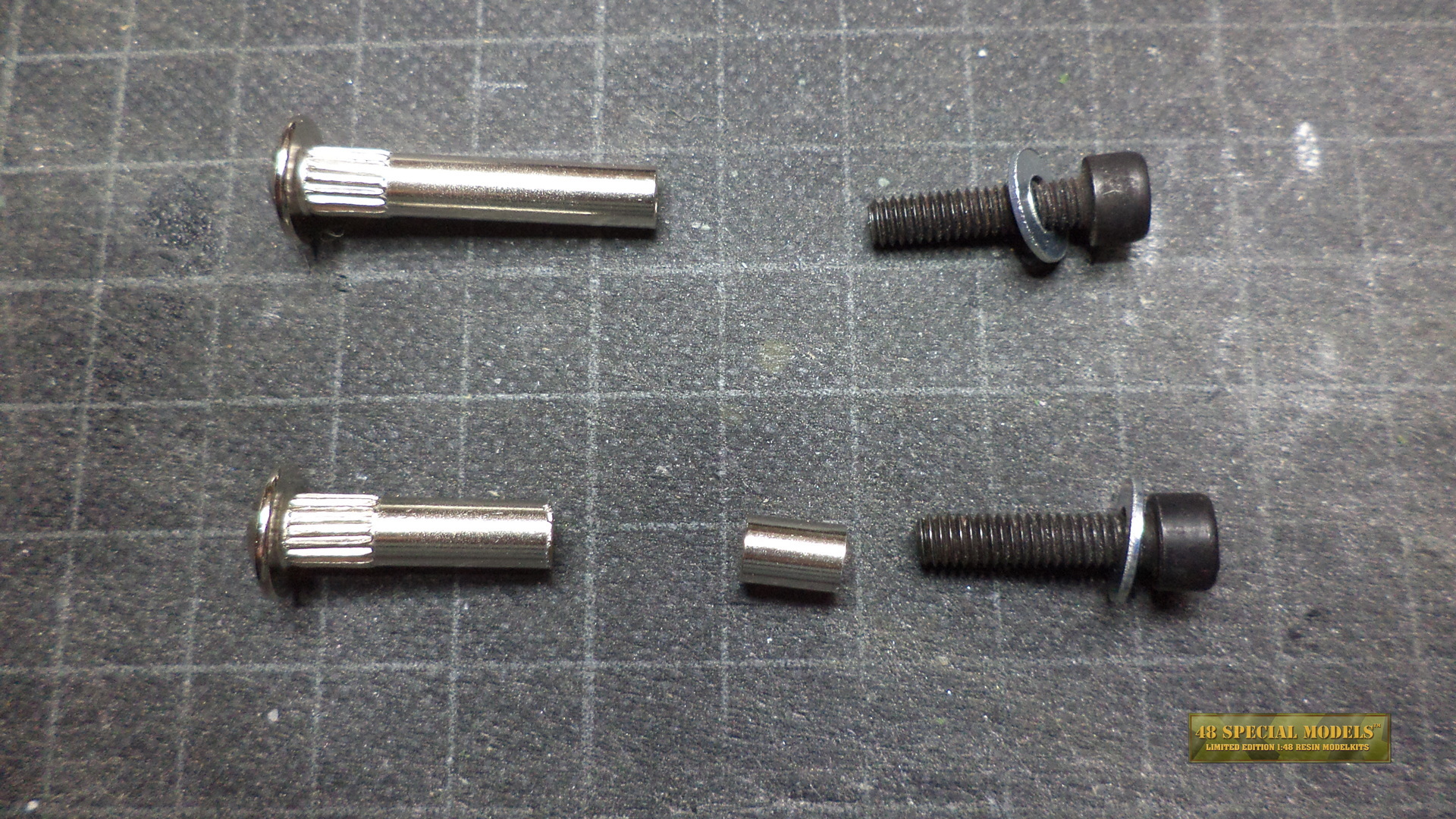 |  | Sogenannte Möbelverbinder oder Gewindehülsen dienen als Lager.
Sie werden auf 7mm Länge gekürzt und auf eine M4 Innensechskantschraube von ca. 14mm Gewindelänge geschraubt.
Vorher nicht die Unterlegscheibe vergessen. | Der Schraubbolzen fertig zum Einbau.
Hier
ist noch nicht berücksichtigt das eine zweite U-Scheibe vor der
Hülse benötigt wird, um den korrekten Abstand der Laufrolle
herzustellen! |  |  | | Wichtig
die Unterlegscheibe und der Schraubenkopf müssen noch unter die
Abdeckkappe passen! Ansonsten andere Kopfform oder Größe
nutzen. Die hier hat definitiv nicht gepaßt und mußte durch einen Rundkopfschraube getauscht werden. | Die
Gewindehülse wird nur aufgeschraubt und muß ein bis zwei
Zehntel länger sein als die Kugellagertiefe, damit sich das Rad
frei dreht. Vorher noch die zweite U-Scheibe auflegen! |
|
Der Scheinwerfer
Der
Scheinwerfer diente sowohl als Lichtquelle für weißes als
auch für infrarotes Licht. Zusammen mit einer
Nachtsichtzieleinrichtung für IR-Licht wurde damit das
Gefechtsfeld ausgeleuchtet.
Alle Scheinwerfer waren meist ungetarnt
und einfarbig olivgrün. Da sie vermutlich häufiger gewechslt
wurden, hätte das ansonsten merkwürdig ausgesehen. Es gab aber
auch Ausnahmen.
Die Hauptkomponenten des Scheinwerfers sind sein
Gehäuse, der Hohlspiegel, die Lichtquelle und die Frontscheibe mit
Halterahmen. Da auch diese Teile opak weiß produziert wurden und
daher sehr Lichtdurchlässig sind habe ich sie, nach dem Grundieren
mit Kunststoffhaftgrund, schwarz lackiert. Dazu verwendete ich einfaches Rally Lackspray matt schwarz.
Nachdem alle Teile
getrocknet sind wurde der Frontrahmen und das Gehäuse von
außen olivgrün lackiert. Damit dabei keine Farbe ins
Innere gelangt, wurde das Gehäuse einfach mit etwas
Küchenkrepp gefüllt.
Am
Hohlspiegel zeigten sich nach
dem schwarzen Anstrich die Spuren des 3D-Druckprozeßes. Hier hat
der Drucker nicht sauber gearbeitet oder war nicht richtig kalibriert.
Also Schleifpapier her und glätten, dann nachlackieren. Die
silberne Beschichtung erfolgt später. Dazu verwende ich
Chromeffekt Lackspray. Leider zeigen sich danach nicht druckbedingte
Spuren die gefüllt werden müssen. Also alles nochmal!
Mit den
Scheinwerferteilen wird eine passende Schablone zum Zuschneiden der
Frontscheibe mitgeliefert. Sie ist praktischerweise mitgedruckt und
funktioniert perfekt, auch wenn ich die chinesische Beschriftung darauf
nicht entziffern kann.
Die Scheibe wird mit einem
Permanentmarker angezeichnet, mit einer Nagelschere grob zugeschnitten
und dem Schleifklotz passend zurechtgefeilt. Für den Bandschleifer
ist das Material zu dünn, daher ist Handarbeit nötig.
|
 | 
| | Die Hauptteile des Scheinwerfers. | Scheinwerfergehäuse innen und außen zuerst schwarz lackiert! |  |  | Kann passieren, der Drucker hat nicht sauber gedruckt.
Dafür gibt es Schleifpapier. | Anschließend wieder scharz lackieren. |  | 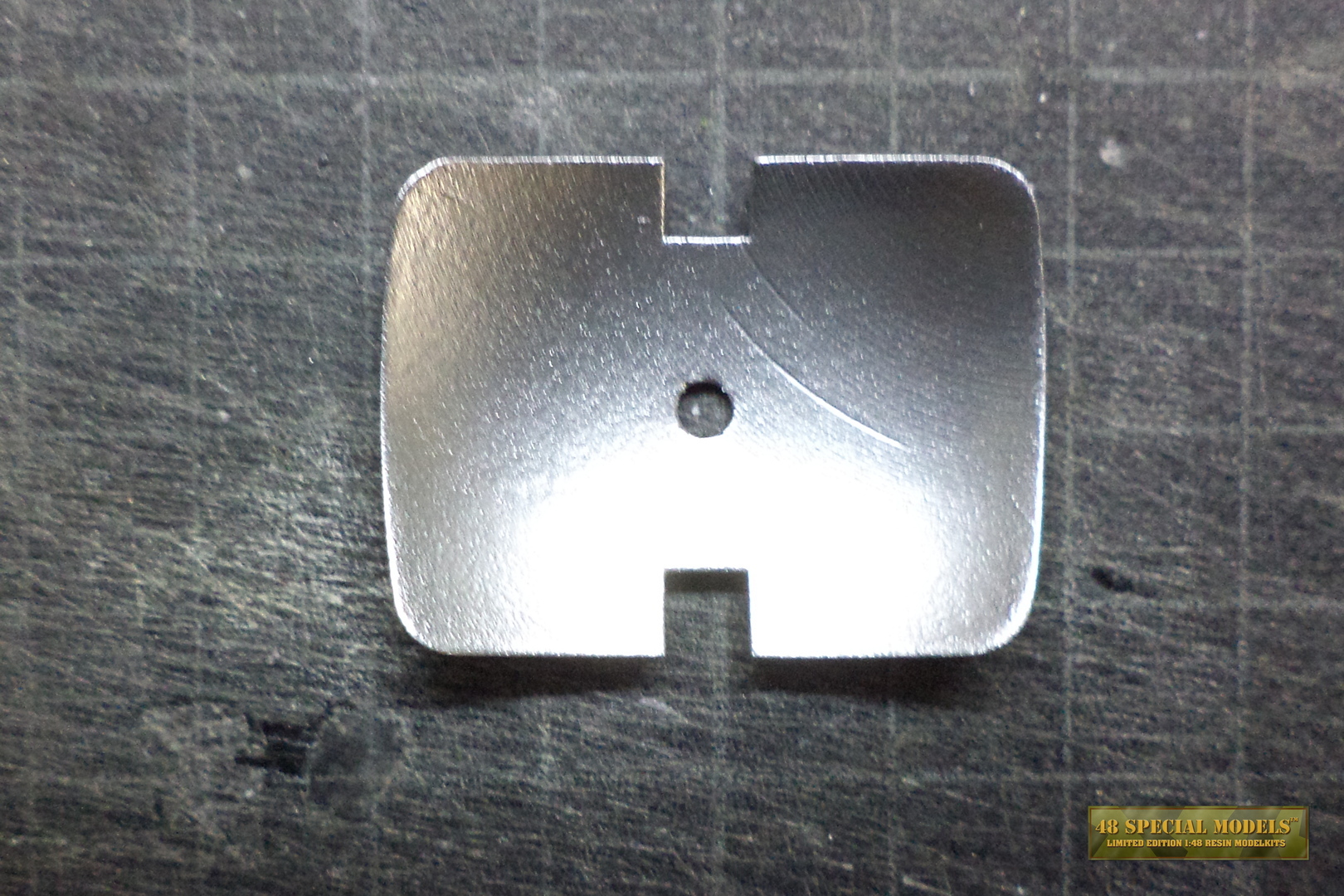 | | Schablone
für die Frontscheibe auflegen und anzeichnen, dann ausschneiden
und zurechtfeilen. Das Restmaterial für die Scheinwerfer aufheben! | Den Hohlspiegel kann man gut mit Chromeffekt Lackspray veredeln. Die Riefen vom Druck scheinen hier noch durch.
Das wird noch geändert! | 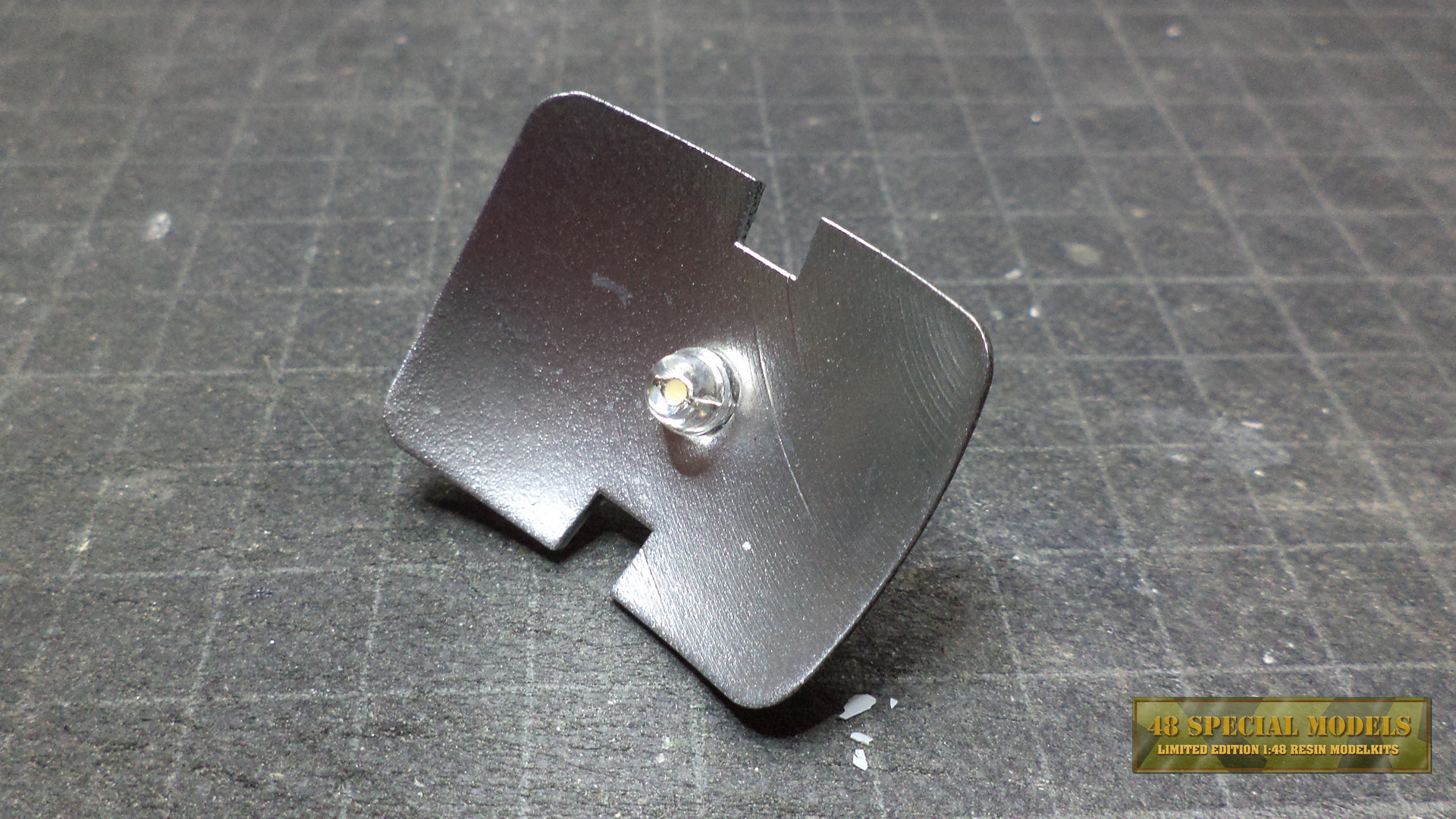 | 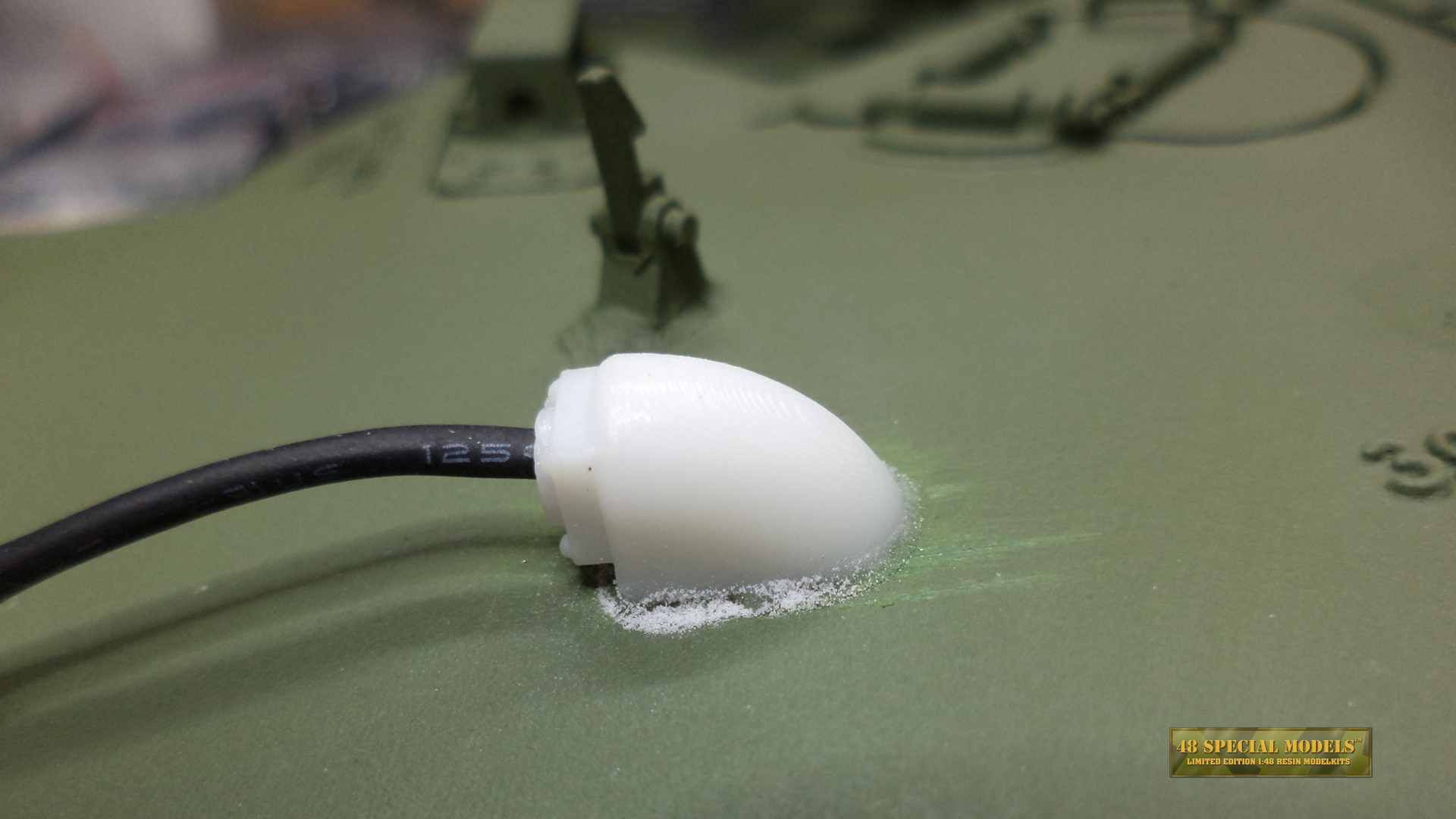 | Die mitgelieferte warmweiße LED ist 5x3mm und zu groß!
Sie muß durch eine 3mm LED, die von hinten eingesetzt und
angeklebt wird, ersetzt werden.
| Die beiliegende Kabelführung samt Kabel wird nun auf dem Turm verklebt und mit einer Schweißnaht verziert.
Das Kabel ist im Original, an beiden Enden, mit einen Schraubstecker angeschlossen. Das wird später noch simuliert. |  | 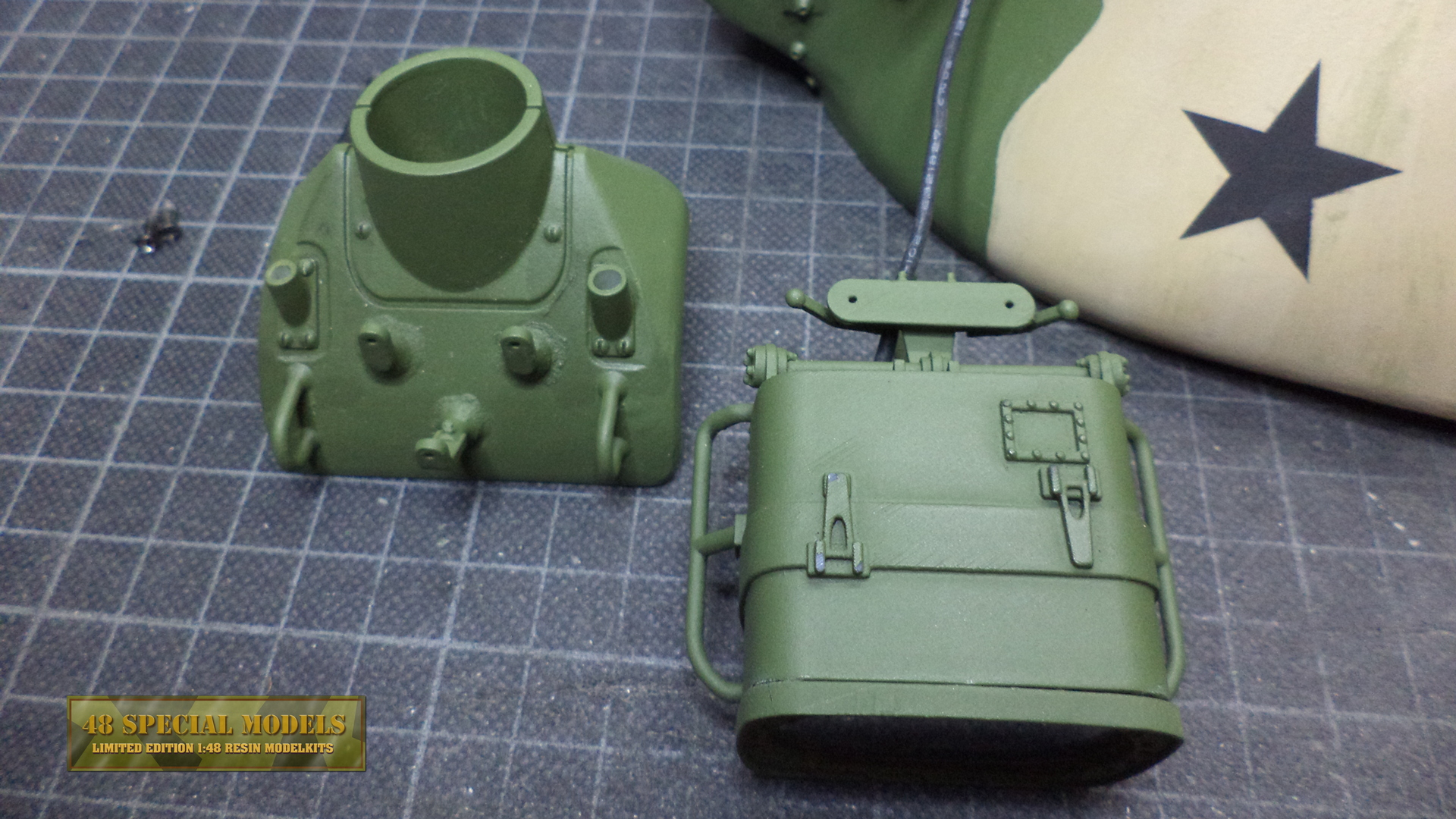 | Das Kabel wird durch die Rückwand eingeführt und
an die LED gelötet. | Der
Spiegel wird dann eingesetzt, aber nicht verklebt! Anschließend
kommt der Lampenhalter hinein, der verklebt werden muß und dann
der Abdeckrahmen mit Glasscheibe. |  |  | Am Original sitzen hier drei Kugeln auf den Haltepunkten auf die der Scheinwerfer gesetzt wird.
| Da
es unmöglich ist hier mit einer Schraube zu arbeiten, (man kommt
mit dem Schraubendreher einfach nicht ran), habe ich 1x10mm Nägel
eingeklebt |  |  | | Auf
diese kann der Scheinwerfer relativ originalgetreu gesetzt werden.
Vorsichtig andrücken und hält auch ohne Klebstoff, wenn die
Nägel minimal schief stehen. | Im
Original sind die Kugeln von unten mit einer Sechskantschraube durch
die Platten verschraubt. Das ermöglicht es sie zu justieren.
Die Nagelköpfe geben den Eindruck relativ gut wieder. | 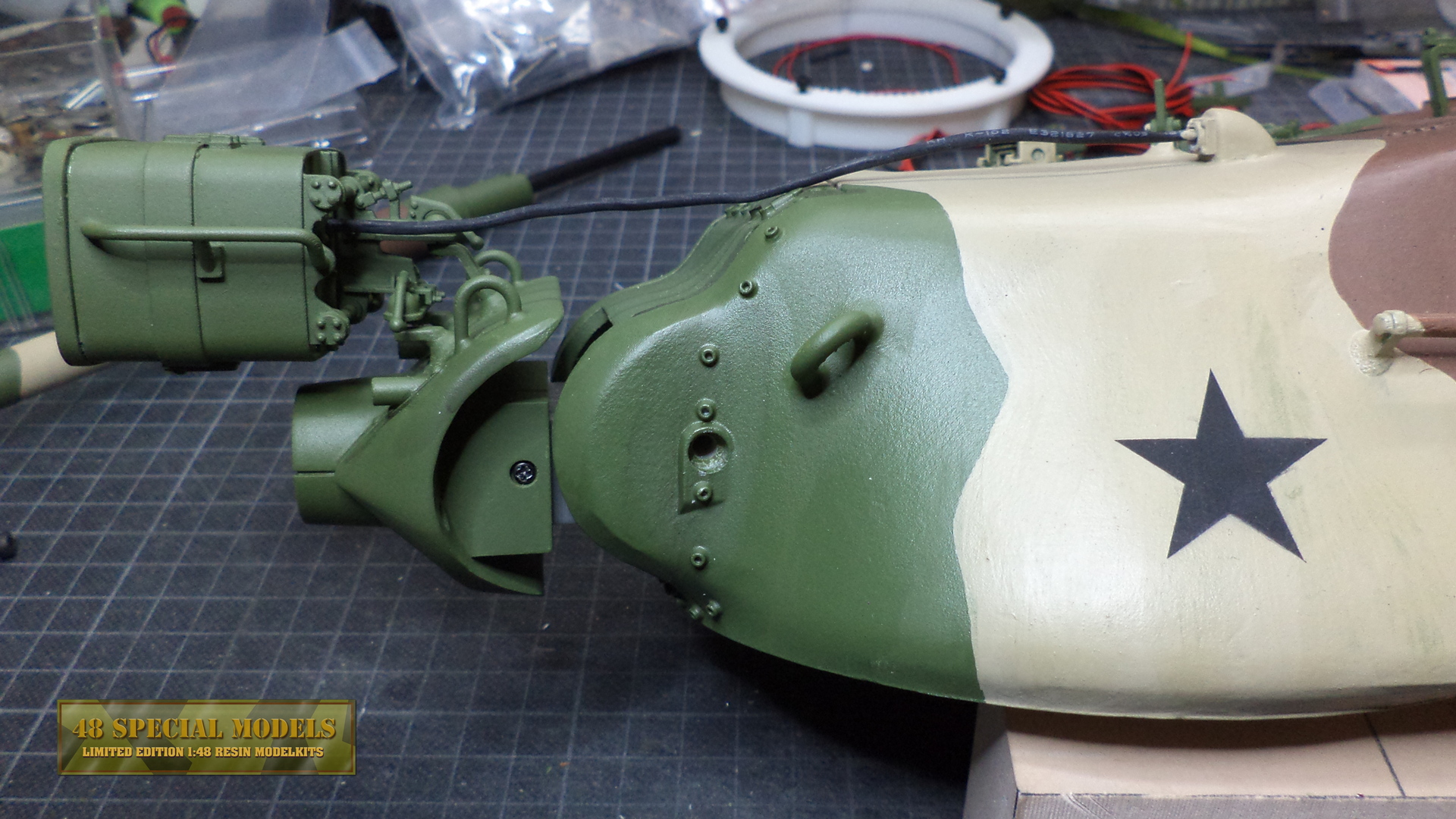 | 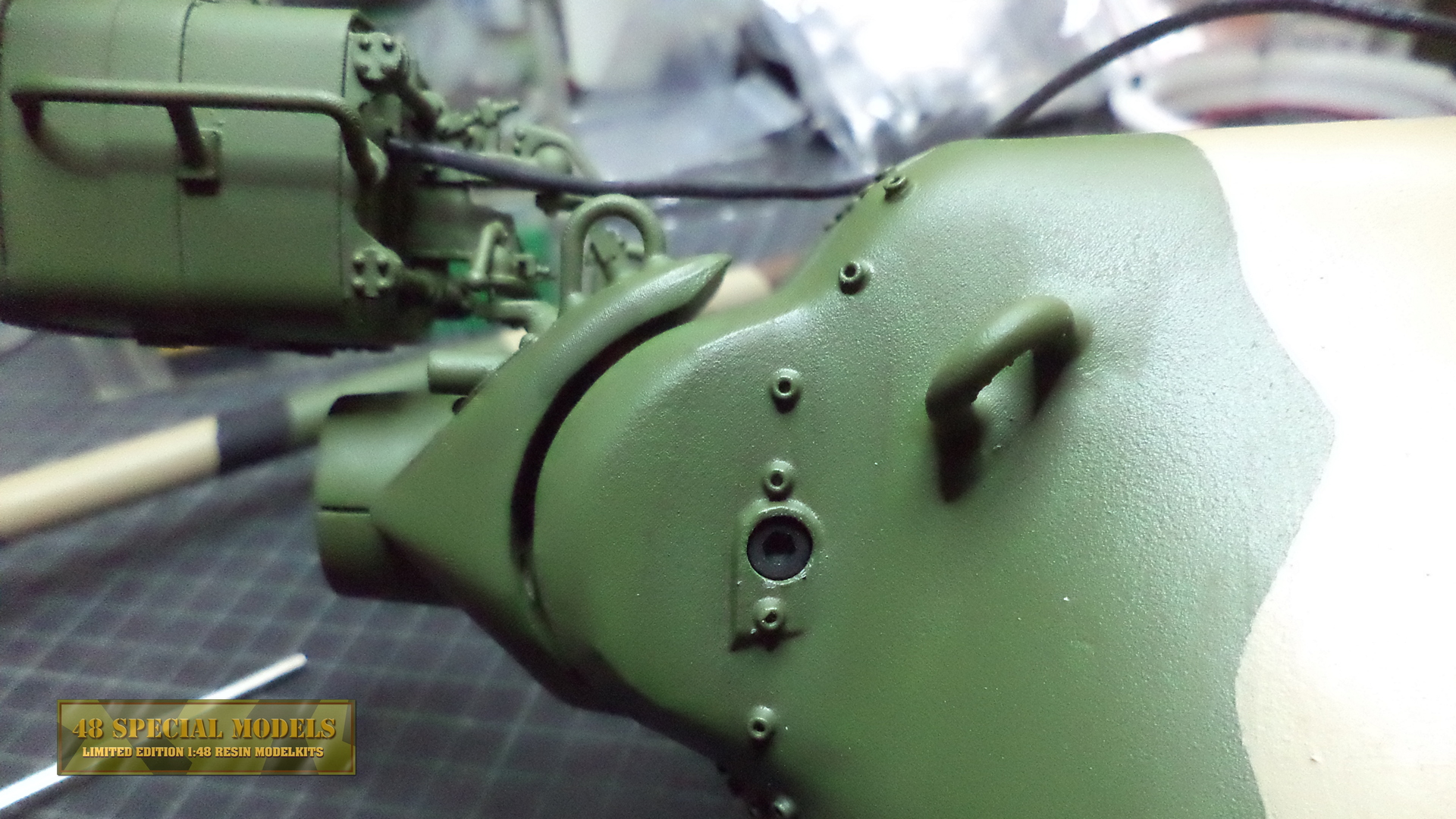 | | Man
sollte schon vorher daran denken, das das Kabel ausreichend lang genug
ist um samt Rohrwiege ein- und ausgebaut werden zu können! | Ich
habe die mitgelieferte Kreuzschlitzschraube zur Befestigung der
Rohrwiege durch einen schwarze Innensechskantschraube gleicher
Größe ersetzt. Diese kommt dem originalen Bolzen optisch
näher. |  |  | | Das
Kabel ist am Original beidseitig mit schraubbaren Steckern
angeschlossen. Man kann das einfach mit etwas selbstklebendem
Metallband simulieren. | Ich verwende ein dünnes Bleiband und wickele es einfach um den Kontaktpunkt. Ein tropfen Sekundenkleber sichert das Ganze. | 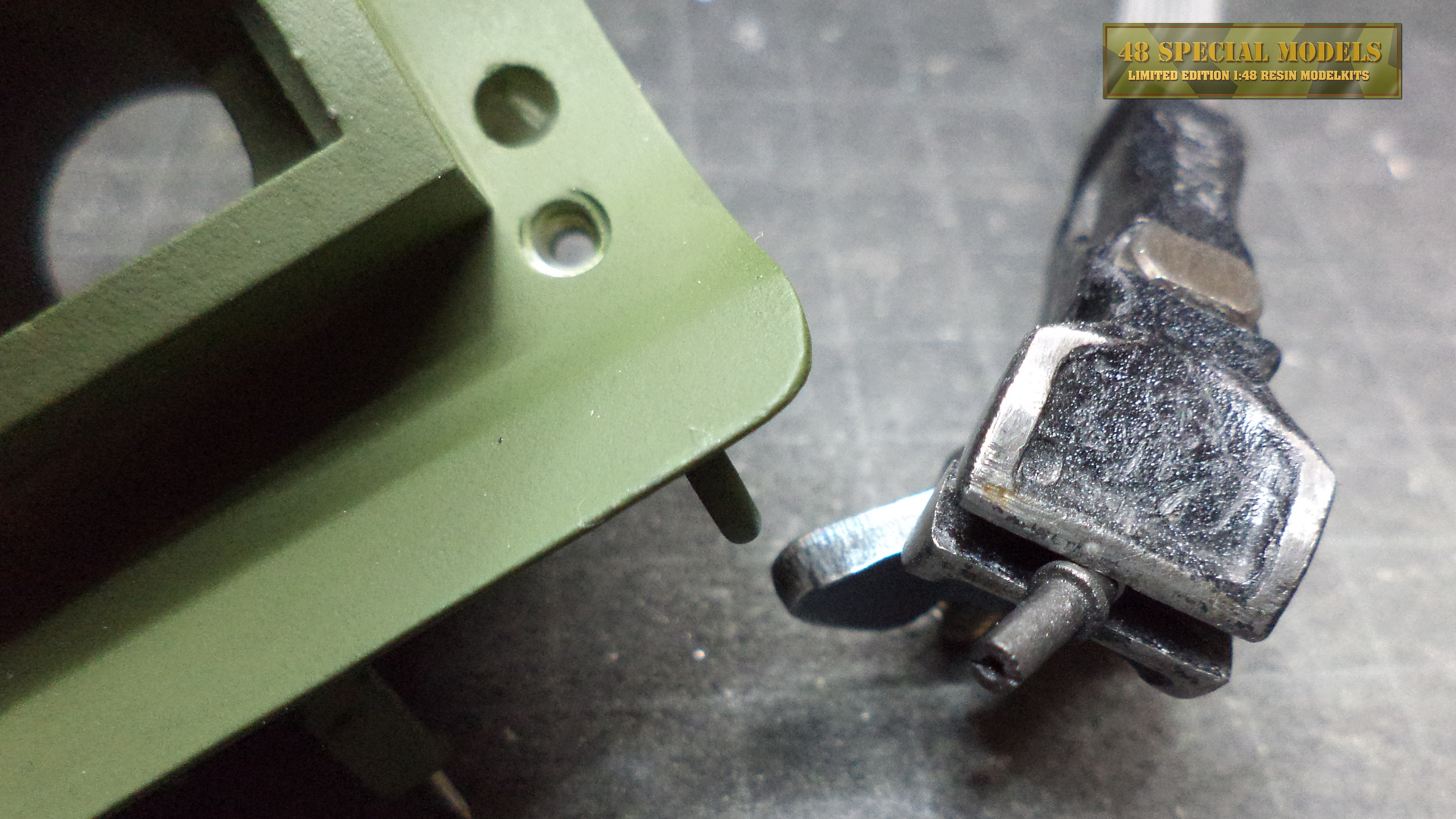 | | | Der
MG-Lauf ist ein Teil aus dem Kit, aber nicht direkt dafür
vorgesehen. Die beim Cal. 0.30 typische Kerbe in der Mündung wurde
mit einer feinen Modellsäge eingeschnitten. | |
Manchmal
braucht es etwas bis der Groschen gefallen ist. Ich habe mir seit
Beginn der Arbeiten die Frage gestellt, was das für eine
Haltebefestigung am Turmheck zwischen den Antennensockeln ist und was
die drei Kugeln daran sollten? Auf meinen Fotos sind die Kugeln nicht
mal vorhanden, daher habe ich sie wie im Text schon beschrieben, auch
entfernt und durch Löcher ersetzt. Doch während ich weiter
gearbeitet habe, fragte ich mich irgendwann wo die Besatzung so alles
verstaut und was sie mit dem Scheinwerfer macht, wenn sie ihn abbauen
mußten, um an die Rohrblende zu gelangen oder aus welchem Grund
auch immer. In den Panzer bekommt man das Teil nicht, die Luken sind
zu klein. Bleibt nur eine Montage an der Außenseite und das
möglichst außer direkter Schußweite, also hinten. Da
dämmerte es mir, die merkwürdige Halterung am Turm dient zur
Befestigung des Scheinwerfers wenn er nicht gebraucht wird. Und da er
an Kugelklemmen befestigt wird sind natürlich auch die Kugeln
angebracht! Manchmal dauert es halt länger bis der Gr....
Daher die Kugeln am Halter nicht entfernen, es sei denn man montiert den Scheinwerfer dort!
Die
Montage des Schreinwerfers ist etwas kniffelig. Zuerst muß eine
passende LED für den Hohlspiegel gefunden werden, da die
beiliegende zu groß ist. Eingebaut werden muß eine 3mm
warmweiße LED die von hinten durch das Loch im Spiegel eingesetzt
und festgeklebt wird. Einstecken allein hält leider nicht. Grund
hierfür ist der später von vorne montierte U-förmige
Lampenhalter. Der hat innen/hinten ein 3mm großes Loch, in
welches die LED eingepaßt wird!
Das Anschlußkabel wird
dann durch die Scheinwerferrückseite eingeführt und mit der
LED verlötet. Anschließend testen ob sie brennt und dann das
Kabel auf die notwendige länge aus dem Gehäuse ziehen, dabei
den Spiegel von vorne einsetzten, nicht einkleben!
Achtung! Um die
gesammte Baugruppe aus Rohrwiege und Scheinwerfer ein und ausbauen
zu können unbedingt ausreichend Kabellänge behalten. Das
Kabel läßt sich nur schwer bis garnicht in den Scheinwerfer
zurückschieben, daher die Länge vorher ausmessen und das
Kabel innen fixieren!
Von vorne wird nun der Lampenhalter
eingeklebt. Der muß in die beiden Löcher auf der
Rückwand und die Bohrung in seiner Mitte nimmt die LED auf. Man
sollte die Position der LED vorher mal testen um sicherzustellen, daß
das Licht auch noch herauskommt. Denn wenn die LED zu tief in der
Bohrung verschwindet bleibt es duster!
Paßt alles wird die
Scheibe mit dem Rahmen festgeklebt. Dazu sollte man nicht unbedingt
Sekundenkleber nehmen, da dieser ausblühen könnte und einen
weißen Niederschlag auf der Glasinnenseite hinterläßt.
Der
Scheinwerfer sitzt beim Original auf Kugeln und wird mit drei Hebeln
festgespannt. Am Scheinwerfermodell sind diese schön zu sehen,
aber ohne Funktion in dieser Größe. Die Halterung weist zwar
Bohrungen auf aber mit Anschrauben ist da nix, da man nicht mit einem
Schraubendreher an die Schrauben heran kommt.
Meine
Lösung
sind 1x10mm Nägel die ich von unten durch die Löcher schiebe
und festklebe. Dabei werden sie mit minimalstem Schrägstand
eingeklebt. Dadurch verkeilen sie sich beim aufsetzten des
Scheinwerfers und halten diesen auch ohne Klebstoff sicher. Der
Scheinwerfer sollte danach möglichts selten abgenommen werden, da
sich die Verbindung sonst lockert.
Das
Stromkabel für den Scheinwerfer ist beim Original beidseitig mit
zwei verschraubbaren Stecken angeschlossen. Diese sind aus Metall und
entweder blank oder grün lackiert. Sie haben in der Regel einen, an
einer kleinen Kette befestigten, Deckel mit dem der Anschluß am
Kabel gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt werden
soll, wenn er demontiert ist.
Leider
liegen dem Bausatz diese Teile
nicht bei, daher muß man sie selbst improvisieren. Man kann sich
jetzt hinsetzen und am Computer ein akkurates maßstäblich
korrektes Teil entwerfen und dann mit einen passenden 3D-Drucker
ausdrucken oder man nimmt wie ich ein Stück dünnes Metallband
(z.B. selbstklebendes Bleiband, gibt es im Bastelbedarf für
Bleiglasdesigner), schneidet sich einen Streifen passend zu und wickelt
ihn um das Kabel. Da ich die Enden schon fest installiert habe, bleibt
mir nichts anders übrig. Wer noch das lose Kabel hat kann sich mit
passenden Röhrchen etc. behelfen.
Ich sichere alles noch mit einem Tropfen Sekundenkleber und fertig. Dauer ca. 2 Minuten!
In
der Rohrblende sind zwei Bohrungen rechts und links der
Rohrdurchführung. Die Linke dient der Aufnahme der Zieloptik, in
der rechten sitzt ein Cal. 0.30 MG-Lauf. Ein dem MG-Lauf
entsprechendes
Kleinteil liegt dem Kit bei, ist aber nicht wirklich dafür
vorgesehen.
Mir fiel das auch erst auf, als ich die Blende schon verbaut hatte, aber
glücklicherweise läßt sie sich leicht demontieren. So
mußte ich den MG-Lauf nachträglich einbauen. Nachdem ich das
Bauteil entdeckt hatte und zuerst dachte es sei dafür gemacht,
mußte ich feststellen das dem nicht so war. Zum Einen fehlte in
der Mündung der Schlitz, der beim Original dem Abschrauben des
Mündingsstückes dient, zum Anderen paßt das Teil nicht
genau in das Loch in der Blende. Da man von allem später nur die
Mündung erkennen kann und das auch nur bei sehr genauem hinsehen,
entschloß ich mich das Teil durch einsägen des Schlitzes
mittels einer feinen Modellsäge zu pimpen, lackierte es und
paßte es ein. Kleber dran fertig!
Die Baugruppe Rohrwiege mit Scheinwerfer
wird dann wieder mit der Rohrrückholmechanik verbunden und mit
zwei Schauben befestigt. Dann kommt die gesamte Einheit wieder in den
Turm und die Rohrwiege wird mit den beiden Innensechskantschrauben
wieder befestigt.
| Schraubklemmen für die Kabelösen
Auf
den Fotos sind am Turm, deutlich erkennbar, die Kabelösen mit
Schraubklemmen befestigt. Diese Kleinteile sind im Kit nicht enthalten,
da der Kleinteilesatz vom M60 zu stammen scheint und der hat da nur
eine Hakenöse, wie rund um den Turm herum auch. Nach Recherche
einer ganzen Reihe von Fotos stellte ich fest, daß der M103A2 die
Seilösen immer mit solch einer Schraubklemme befestigt hatte.
Der M103A1 hingegen hatte hier kein Kabel und am M60 wurde es nur eingehakt.
Bleibt
nur eines zu tun, von Hand bauen. Maße bestimmen geht mit dem Foto
bestens. Auf dem Foto ist das Ösenmaterial genau 2cm dick und die
Öse am Modell hat 2mm Materialstärke. Das erleichtert das
Abmessen. Es zeigt sich aber, daß dieser Halter winzige 1,5mm breit und
1cm lang ist. Na dann mal los.
Aus einem
Polystyrolplattenrest werden zwei kleine Teile geschnitten, die vorher
angezeichnet und gebohrt wurden. Dann spanne ich eines nach dem anderen
in die Haltezwinge ein und feile sie unter der Lupenlampe zurecht.
Den
Metallbügel fertige ich aus einem Restmaterial, das von einem
Ätzteilerahme der Tiger Lüftungsgitter von Aber stammt.
Der Hilfssteg ist genau 1,5mm breit und aus Messing. Abschneiden und
mit der Lötlampe weichglühen.
Mit Hilfe eines Reststücks 2mm Messingdraht
und der Haltezwinge, die genau auf 2,1mm breite eingestellt ist, biege
ich mir den Riegel, indem ich die Zwinge einfach über den Draht
drücke. Das Ösenende wird durch wickeln um einen 1,5mm
Messingdraht hergestellt. Der Draht verbleibt direkt in der Öse
und wird mit Sekundenkleben verklebt. Dann werden beide Ende
bündig mit dem Saitenschneider abgetrennt und beigeschliffen. Die
Enden kürzen und alles auf das Kunststoffteil kleben, aber nur auf
der Ösenseite, sonst kann später die Seilöse nicht
eingesetzt werden.
Mit dem Handbohrer werden als
nächste die Schraubenlöcher der Befestigungsschrauben
und der Flügelmutter gebohrt. Sie sind 1 mm dick und gehen
durch
bis in die Bordwand. Dazu werden erst die Schraubklemmen
durchbohrt, dann werden diese an der Bordwand angehalten, positioniert
und festgeklebt. Da der Klebstoff auf der kleinen Fläche wenig
halt hat, werden 1,1mm Sechskantschrauben eingeschraubt.
Anschließend wird der Schweißwulst nachgebildet. Mit dem
Pinsel die Teile farblich anpassen. Das Kabel wird erst eingebaut, wenn
alle Lackierarbeiten am Turm abgeschlossen sind! |
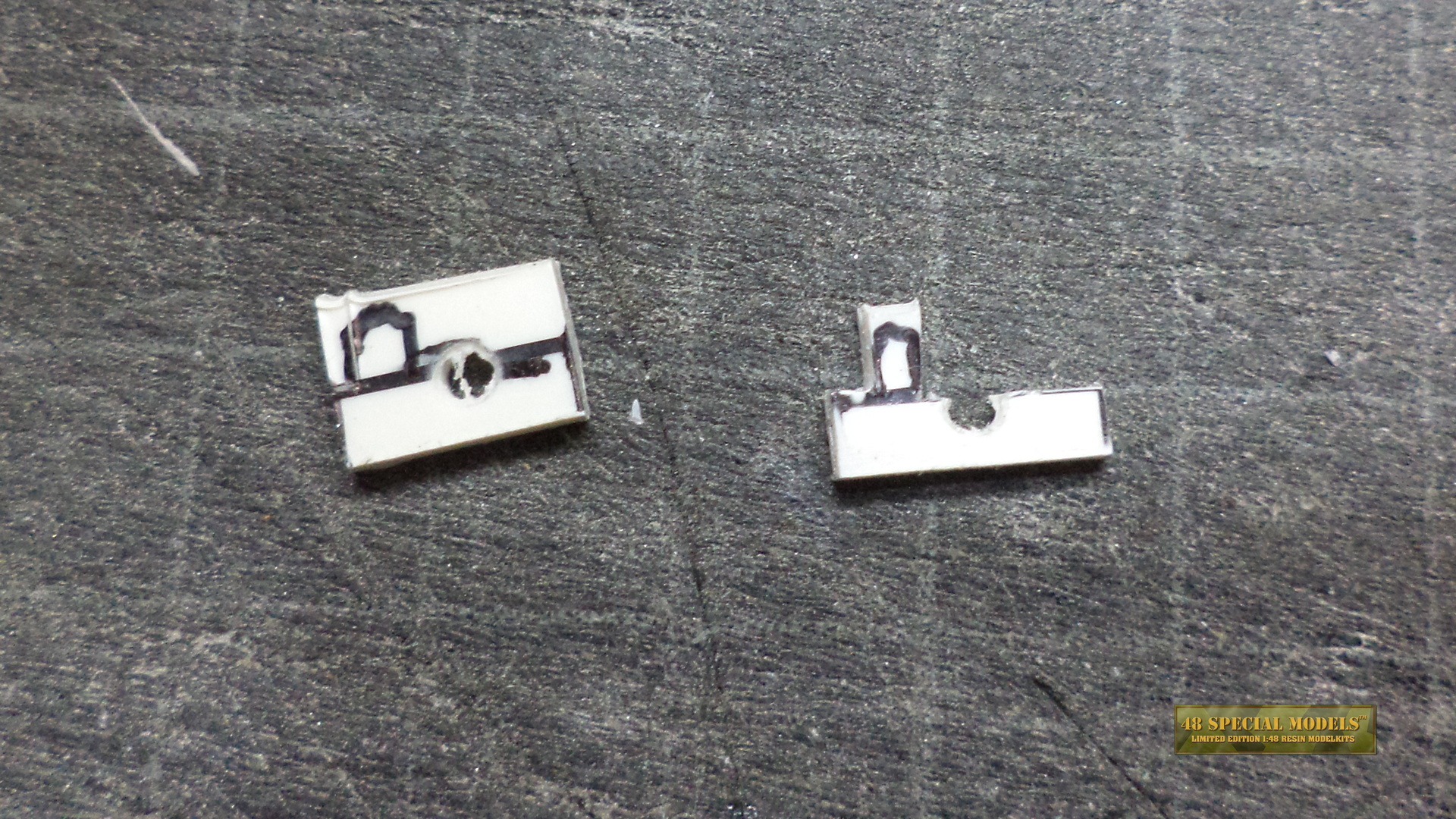 |  | Fehlen im Kit, die Schraubklemmen für die Kabelösen.
Also selberfeilen! | Dank guter Vorlage kein Problem, aber nur mit der Lupenlampe zu bewältigen. | 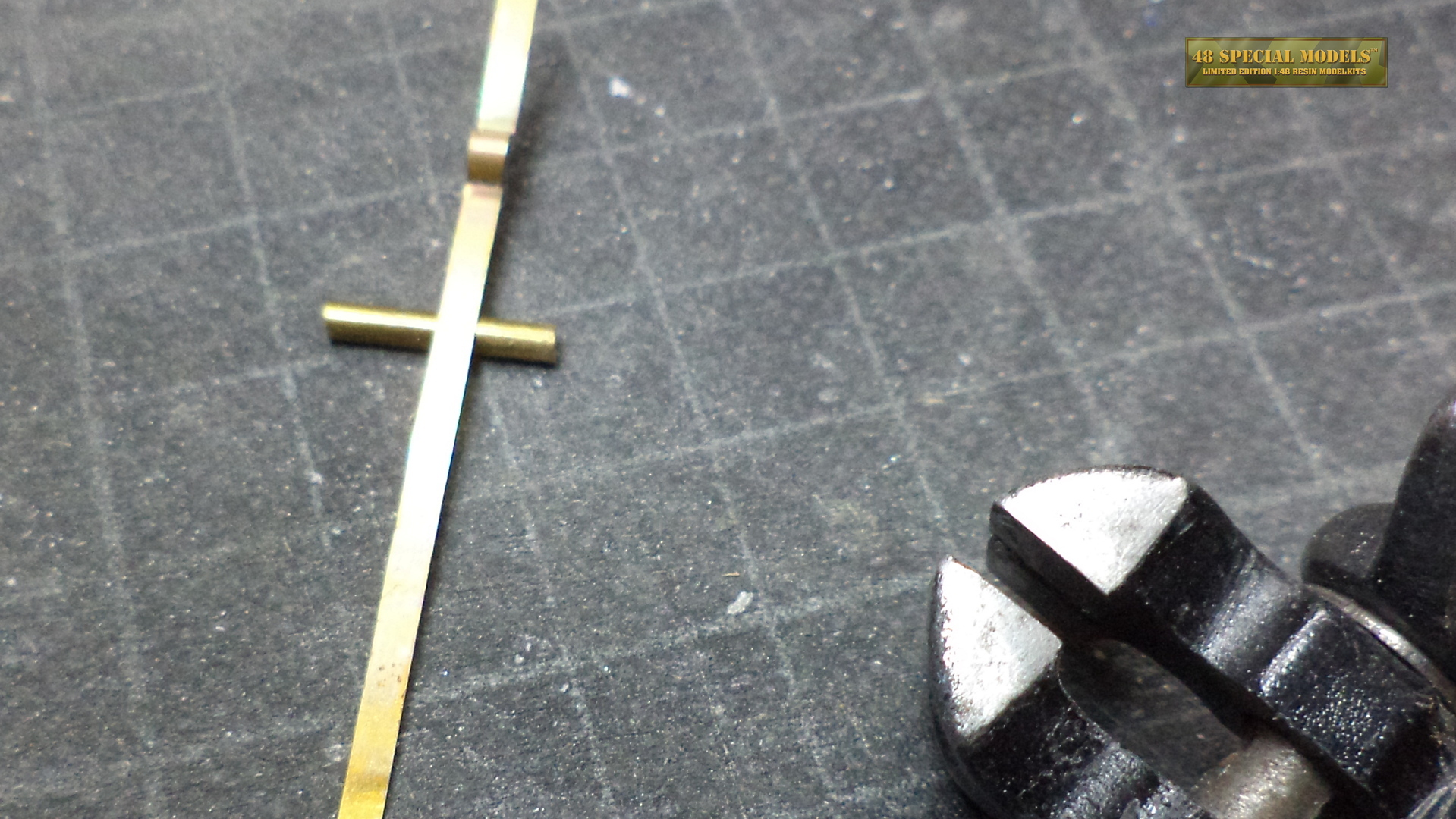 | 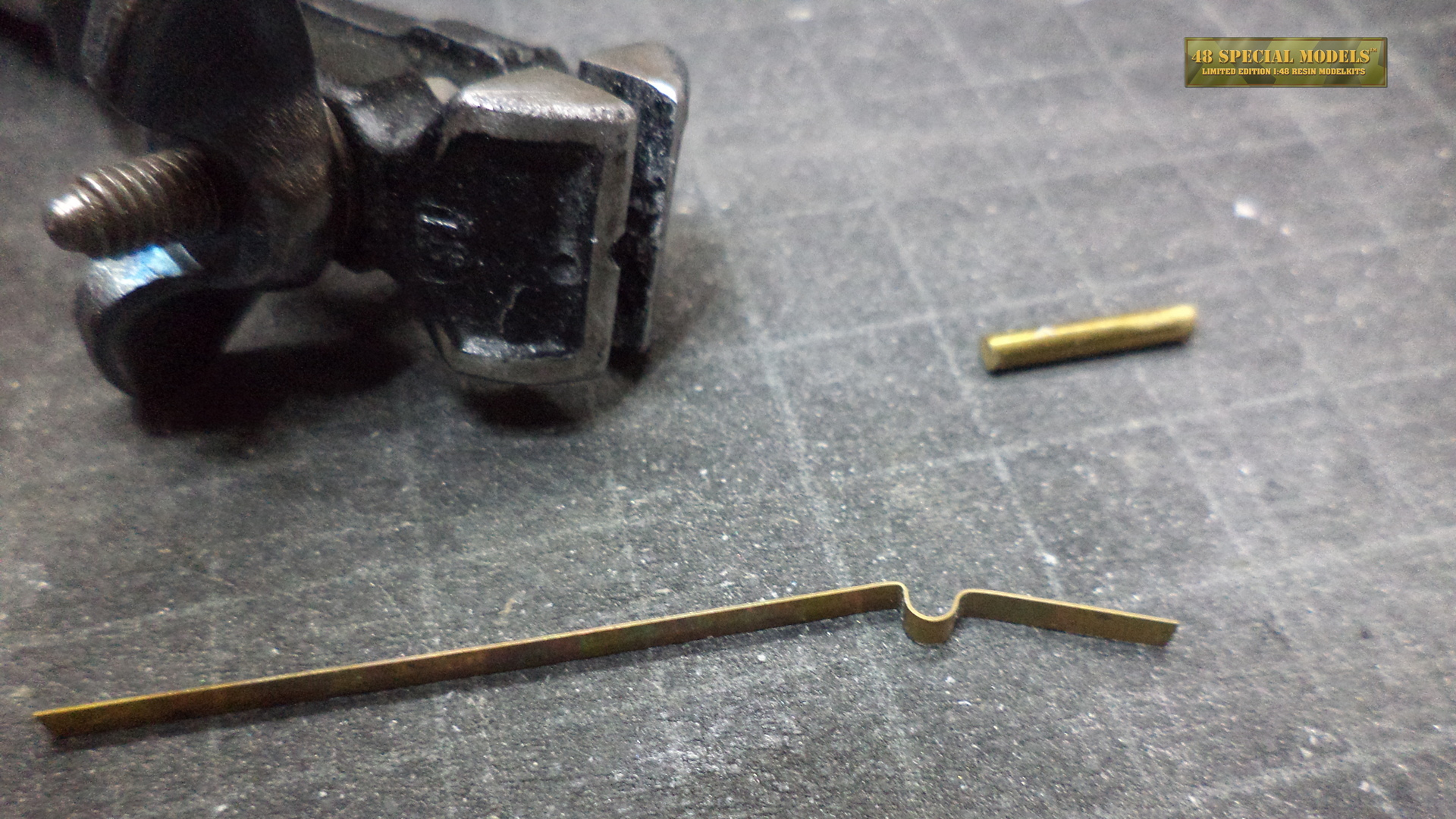 | | Den Riegel biege ich aus Ätzteileresterahmen. Hier vom Tiger Gitter. Die Rahmenstreifen sind genau 1,5 mm breit! | Erst ausglühen damit das Material weich wird. Dann über einen 2 mm Drahtrest, mit Hilfe der Haltezwinge zurechtbiegen. | 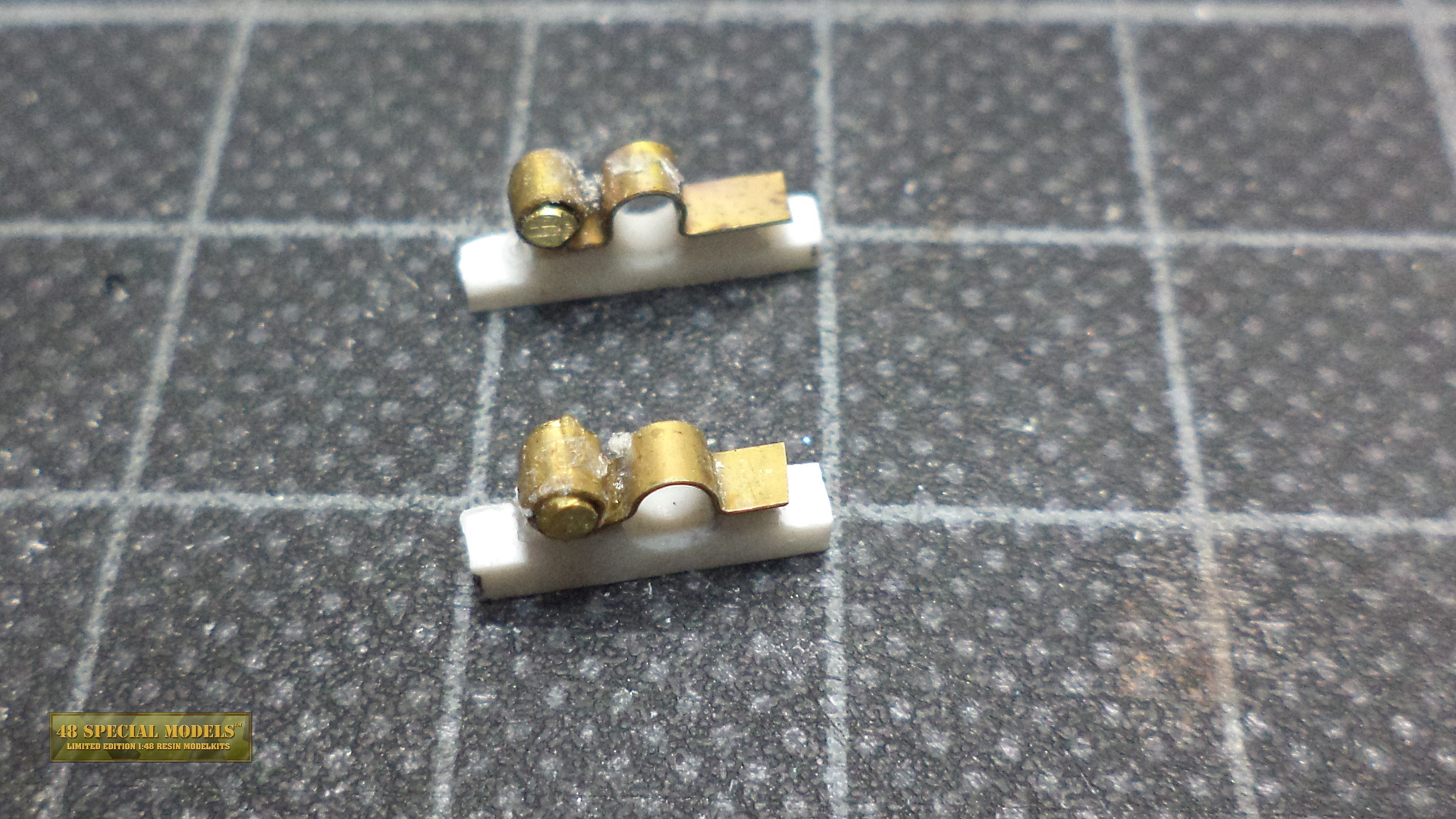 |  | | Da
an ein funktionierendes Scharnier bei dieser Größe ohne
Ätzteilesatz nicht zu denken ist, wird alles nur gefakt. | Vor dem Ankleben erst die Löcher Bohren! Mit einem 0,7mm Bohrer wird begonnen, dann mit einem 1mm aufgeweitete. |  |  | | Anschließend
wird das Bauteil über das vorhandene Loch in der Turmwand geklebt.
Der Untergrund wurde vorher angeschliffen. | Mit
Sekundenkleber und Füllmittel wird dann die "Schweißnaht"
gelegt und anschließend die Löcher durch die Turmwand
gebohrt. |  |  | | In die Löcher dann die subminiatur Sechskantschrauben einsetzten und von der Turminnenseite her verkleben. | Fertig zur Bemalung.
Die
Schraube die das Scharnier sichert ist natürlich nicht verklebt,
ansonsten kann ja das Auge des Stahlkabels nicht eingesetzt werden! |
| Die Gußmarken des Herstellers
Auf
den Fotos sind deutlich die herstellerseitig angebrachten
Gußmarken und Nummern zu erkennen. Leider fehlt das
Herstelleremblem, obwohl die Nummern vorhanden sind. Grund hierfür
könnte der Markenrechteschutz sein, da der Hersteller noch
existiert!
Es wurmte mich tagelang wie ich denn bitte das Logo
möglichst in passender Größe auf die Turmseite und die
Turmoberseite bekomme, denn auf den Fotos prangen sie da deutlich
sichtbar!
Mir gingen alle mögliche Abläufe durch den
Kopf, wie man das hinbekommen konnte, aber alle waren ziemlich
zeitaufwendig. Beim heruntelassen der Rolläden in meinem
Modellbauzimmer fiel mein Blick auf den Karton des Matorro M4 Sherman,
den ich direkt vor dem Fenster stehen hatte und was sehe ich auf dem
Foto? Genau das Gußemblem auf der Frontwanne! Das Modell steht
gerade sowieso schon zerlegt in der Werkstatt, weil es schon
längst hätte lackiert und gesupert werden sollen!
Also nix wie hin und ran ans Werk. Schlagartig war mir klar wie ich es mache!
Man
nehme etwas Knete, ganz gewöhnliche Knete zum Modellieren. Forme
eine Kugel, daraus einen runden Strang und schneide ein kurzes
Stück ab. Dieses drückt man nun auf das Logo und hebt es ganz
vorsichtig wieder ab, möglichst ohne es zu verbiegen! Ansonsten
nochmal von vorne.
Die Stelle am Turm mit Schleifpapier anrauhen, möglichst bis auf das Material, dann säubern.
Jetzt
kommt der Teil den nicht jeder auf Anhieb nachmachen kann. Ich
rühre mir eine kleine Menge (2-3g) PU-Resin an und fülle die
Knetform damit. Mit einem Wattestäbchen entferne ich
möglichst allen Überschuß, vor allem am Rand. Dann
drücke ich die Knetform vorsichtig mit sanftem Druck gegen die
Panzerwand. Zuvor habe ich mir eine Markierung an der Knete
gemacht, um sie genau positionieren zu können. Den
äußeren Formrand drücke ich so an die Wand, daß er
haften bleibt. Jetzt heißt es warten. Derweil erstelle ich eine zweite
Form für die Oberseite und wiederhole den Ablauf.
Nach circa
einer Stunde entferne ich die Knete vorsichtig. Das Ergebnis ist
erstaunlich gut. Nur wenig Material ist zur Seite herausgequollen und
kann vorsichtig mit Skalpell und Schleifpapier entfernt werden.
Anhaftende Knetereste mit etwas Waschbenzin entfernen.
Nachdem das
Material komplett getrocknet/gehärtet ist, gehe ich mit dem
Schleifflies vorsichtig darüber hinweg, um die Kanten etwas zu
brechen. Anschließend wird alles mit Olivgrün aus der
Spraydose überlackiert, fertig!
|
 |  | | Das Original auf der Sherman Oberwanne. | Nach dem Abdrucknehmen mit Knete. |  |  | | Die Stelle am Turm anschleifen. | Resin auf den "Stempel" und an die Wand drücken. Trocknen lassen. |  |  | Das Ergebnis ist wirklich gut.
Mit etwas Waschbenzin läßt sich anhaftende Knete entfernen! | Anschließend mit der Spraydose überlackieren!
Sieht aus als wäre es immer da gewesen. | 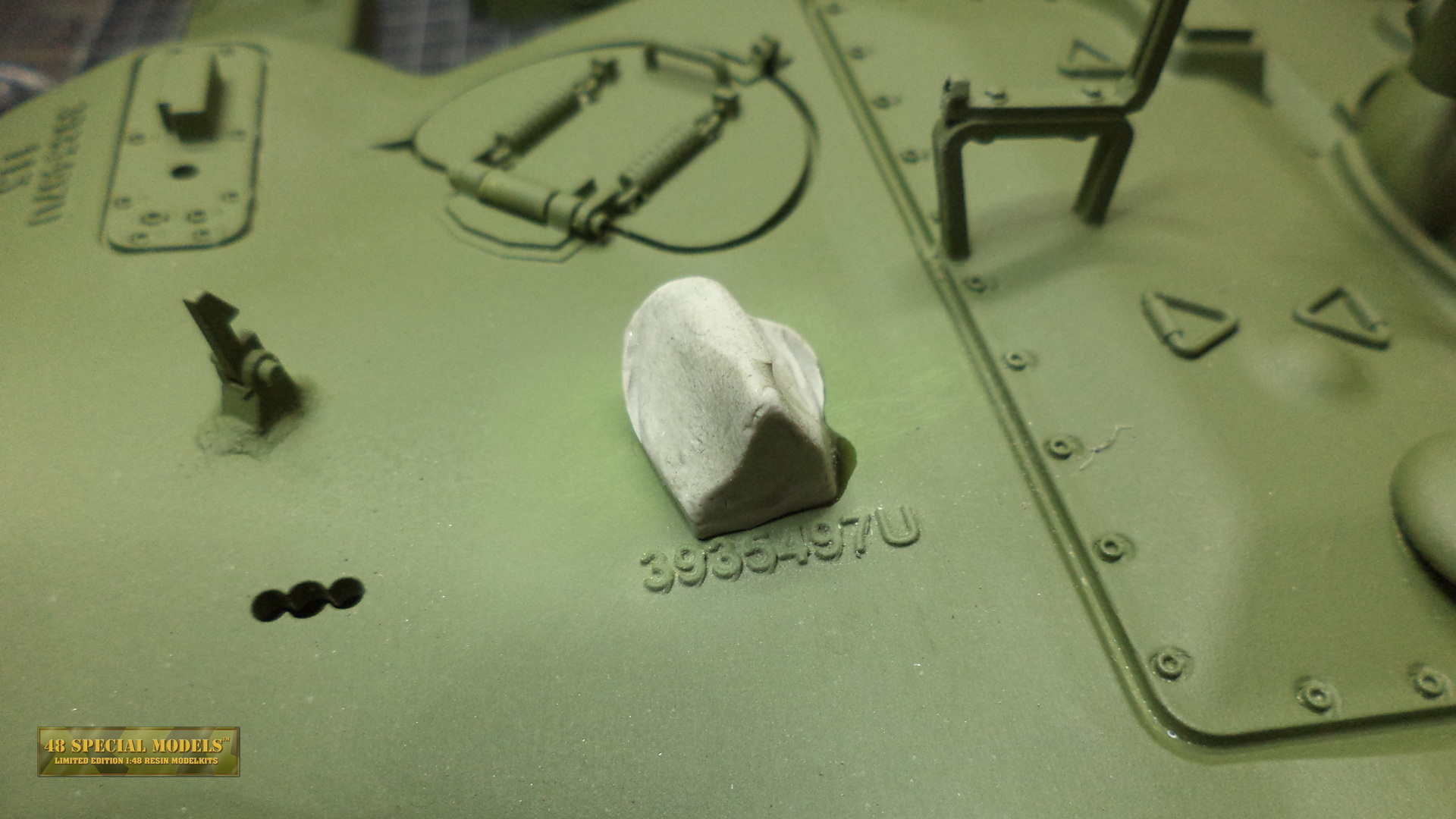 |  | | Das Ganze noch mal auf der Turmoberseite. | Hier ist des Relief nicht ganz so tief oder die Zahlen zu tief?! | 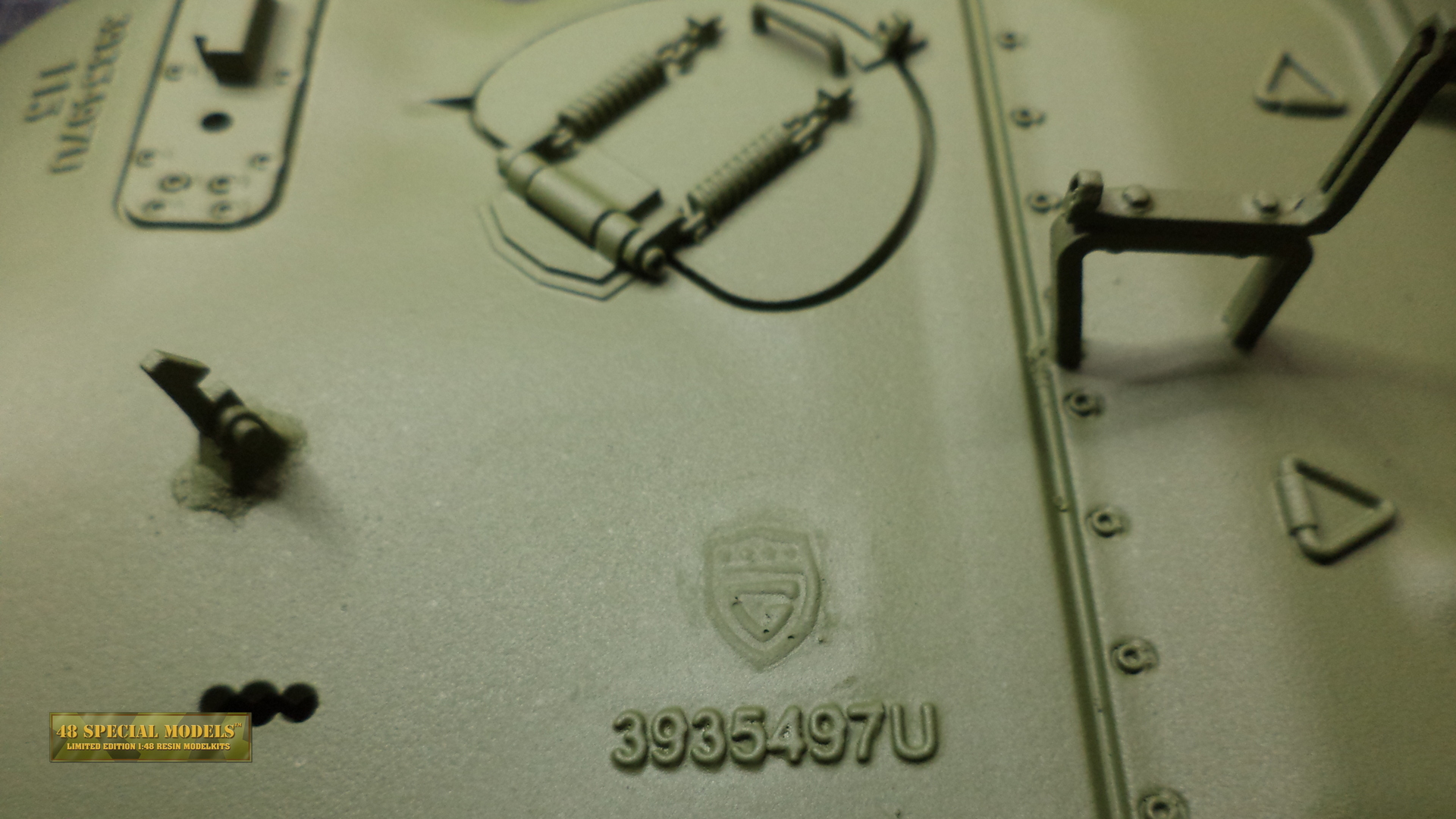 |  | | Überlackieren und egal! | So sieht der Turm schon besser aus! |
| Der Tarnanstrich nach MASSTER Tarnschema
Zum
Anstrich nach MASSTER (Modern Army Selected Systems Test, Evaluation and Review) gibt es ein empfehlenswertes Heft von Tankograd,
in dem die meisten Fakten gut beschrieben sind. Wer sich dafür
interessiert sollte sich das Heft besorgen, bevor er mit einer solchen
Tarnlackierung anfängt. Ich möchte hier nicht weiter auf die
Hintergründe von MASSTER und den damit verbundenen Tarnanstrichen
eingehen. Es sei nur gesagt, daß die Amerikaner in den 1960-80er
Jahren intensive, wissenschaftliche Versuche zu Tarnmustern und
Farbzusammenstellungen unternommen haben. Heraus kamen der als MASSTER
bekannte 4-Farben Tarnanastrich und der sogenannte MERDC Anstrich. Der
MASSTER wurde zudem in einer Sommer und einer Winter Version definiert.
Der hier gezeigte Anstrich ist die Sommerversion, gerne auch als
"Woodland Hell" bezeichnet.
Der Anstrich besteht aus einer Grundfarben
in Gelboliv RAL 6003, den Farbtönen Sand hell (Tamiya XF-57 Buff),
Rot Braun (XF-63) und Schwarz (XF-11)
Obwohl
der olivgrüne Anteil im Verhältniss zum Sand und Braun viel
geringer ist, wurde das Modell mit Olivgrün grundiert. Den Grund
hierfür hatte ich oben schon beschrieben.
Wichtig ist, daß die
Tarnfarben eine harte Trennlinie haben und das sie von hell nach dunkel
aufgetragen werden. Im Gegensatz zu späteren Anstrichen sind hier
die Kanten messerscharf! Nach dem Handbuch sollte der Anstrich
nämlich mit dem Pinsel von Hand durch die Soldaten aufgetragen
werden. Einzig die Musterverteilung und die prozentualen Farbanteile
waren vorgegeben.
Das führte zu sehr unterschiedlichen
Tarnmustern, bei den gleichen Fahrzeugtypen. Leider gibt es vom M103A2
keine Fotos die mir bekannt wären in diesem Anstrich, obwohl die
Zeit seines Einsatzes noch in die Ära der MASSTER Tarnung fiel.
Der M60 A1 ist, als direkter Nachfolger, aber auf vielen Bildern zu
finden und kann daher als Grundlage dienen. Keine Fotos bedeutet aber
auch keine Fehler bei der Farbgebung, denn es gibt ja keine
Originalvorlagen.
Da mir das Abkleben der Wanne und der
Oberwanne für eine Airbrushlackierung viel zu aufwändigt war,
habe ich mit dem Pinsel gearbeitet. Dazu benötigte ich Pinsel mit
Rotmarder Haaren, die sehr weich und biegsam sind. Die
Größen 3 und 4 reichen. Für den flächigen Anstrich
kann man aber auch noch einen breiten Flachpinsel nehmen. Wichtig ist
bei der Verwendung der Acrylfarben von Tamiya diese richtig zu
verdünnen. Die Farbe darf nicht zu dünn werden, da sie sonst
nicht mehr deckt. Aber auch nicht zu dick, da sie sich ansonsten nicht
gut streichen läßt und Pinselspuren zu sehen sind. Je nach
Raumtemperatur und Luftfeuchte muß man hier etwas
experimentieren. Ich verwende neben der Tamiya Verdünnung noch
eine zweite "selbstgebraute" Mischung aus 70-50% destilliertem Wasser
und 50-30% Isopropanol. Dabei gilt je mehr Isopropanol desto schneller
trocknet die Farbe. Beim streichen mit dem Pinsel sollte man die
Trockenzeit länger ansetzen, damit sich die Farbe glätten
kann, daher zuerst mit dem Tamiya Verdünner verdünnen und
dann entsprechend der Temperatur und Luftfeuchte etwas Isopropanol
hinzugeben. Testen auf einem Versuchsstück und wenn gut,
dann los!
Man sollte daran denken, daß der Alkohol
während dem Lackieren langsam aus der Farbe, auch in der Farbdose
entweicht und ihn daher gelegentlich nachfüllen. Dabei immer mit
etwas Wasser mischen.
Das Auftragen der Farben mit dem Pinsel
ist mir als Airbrushlackierer fast schon etwas fremd geworden, aber in
diesem Fall macht es Sinn, denn es kommt dem Original näher. Trotz
gründlichem aufmischen der Farben ist leider nach dem Trocknen
meist eine Art helle Streifen zu sehen. Das kommt von dem
eingearbeiteten Mattiermittel. Beim Spritzen verteilt sich dieses
gleichmäßig in der Farbschicht. Beim Pinseln leider nicht.
Daher muß der gesamte Anstrich später noch mit mattem
Klarlack aus der Airbrush überlackiert werden.
Noch etwas ist
anders als beim Spritzen. Es dauer länger, viel länger. Alle
Teile durchzulackieren hat mich mehrer Tage gekostet, mit
Trockenzeiten. Aber das Ergebnis macht die Mühen wett.
Spätestens nach dem letzten Farbton Schwarz, weiß man warum
man die Panzer in so einer Farbgebung gerne auch als "bunte Kühe"
bezeichnete.
Zu beachten ist beim Schwarz, daß es nur
einen sehr kleinen Anteil in der Farbgebung hat und das auch die
Hoheitszeichen, die Sterne, in schwarz ausgeführt wurden. Daher
sollte um die Flächen, an denen die Sterne aufgemalt werden,
ausreichend Abstand gelassen werden. Der Untergrund sollte an diesen
Stellen auch mit Sand Hell lackiert sein um den Kontrast zu maximieren.
Zur Sternengröße:
In
der Anfangszeit der MASSTER Farbgebung waren die Sterne noch sehr
groß aber schwarz. Das lag an der "Kalter Kriegs Zeit". Man
wollte sicherstellen, daß bei der Identifizierung keine Fehler
passieren. Später wurden die Sterne winzig, blieben aber schwarz.
Das wiederum lag daran, daß man erkannte, das die Warschauer Pakt
Staaten ihre Fahrzeuge weiterin nur grün lackierten. Zudem waren
die Sterne das einzige was den Tarneffekt durchbrach und dienten daher
schon (wie auch im WWIII) als Anhaltepunkt für feindliche Panzer.
Man kann daher die zeitliche Zuordnung anhand der Stermgröße
vornehmen.
Im Fall des M103A2 ist nur die frühe Form sinnvoll,
da die Fahrzeuge bei erscheinen der kleinen Sterne schon ausgemustert
waren.
Den
Stern habe ich mir am Rechner erstellt und in einer Größe
von 25mm dreimal ausgedruckt. Das geht bei vielen Grafikprogrammen
relativ einfach, da Sterne dort als geometrische Figuren bereits
in skalierbarer Form vorliegen. Der Ausdruck erfolgte auf normalem
Schreibpapier. Über den Stern klebte ich dann von beiden Seiten
sehr feinen, tranparenten Klebefilm, um die Fläche zu stabilisieren
und Farbaufnahme zu verhindern. Das Ganze wurde dann mit Klebefilm auf
der Schneidematte fixiert und mit einem neuen, extrascharfen Skalpell
und Geodreieck ausgeschnitten. Der Stern wurde anschließend mit
der Schere außenherum so weit beschnitten, das man noch
Malerkrepp anbringen kann und er nicht mit den Anbauteilen kollidiert.
Anschließend
wurde die Schablone von einer Seite mit Sprühkleber leicht
besprüht. Die Sorte Sprühkleber die sich rückstandfrei
wieder lösen läßt!
Diese Schicht trocknen lassen
und dann die Schablone an der passenden Stelle plazieren. Der Stern
sitzt auf beiden Seiten an der ziemlich gleichen Stelle. Darauf achten
das die Spitzen im Inneren gut angedrückt sind und die Schablone
mit dem Innenrand aufliegt. Dann mit Malerkrepp das Umfeld gegen
Sprühnebel sichern. Die Airbrush mit matt Schwarz laden und dann
einen feine ersten Nebel auftragen. Nachprüfen das die Farbe nicht
unter die Schablone läuft oder das sie nicht an der
Oberfläche anliegt. Nun eine deckende Schicht vorsichtig in
mehreren Arbeitsgängen auftragen. Man kann dazu z.B. erst die eine
dann die andere Seite im Wechsel besprühen. Deckt die Farbe, dann
das Ganze etwas antrocknen lassen und anschließend die Schablone
vorsichtig entfernen. Dann durchtrocknen lassen.
Sollte etwas schief gehen die Farbe entfernen und nach dem Trocknen neu beginnen.
Alle
Fahrzeuge haben vorne und hinten noch Identifikationsnummern und rechts
und links an der Seite eine Fahrzeugnummer, der meist das Kürzel
US- ARMY voransteht, je nach Teilstreitkräftezugehörigkeit.
Die Nummern vorne und hinten schlüsseln die Einheit auf und sind
in der Regel in weiß gehalten, bei hellem
Untergrund ín schwarz. Manche Einheiten haben aber das
Weiß durch den Sand Hell Farbton ersetzt, da dieser nicht so
leuchtend ist. In manchen Fällen wurden auch Fahrzeuge gesehen, bei
denen die Beschriftung von einem hellen Tarnfeld in ein dunkles
überging und daher der Farbton wechselte!
Dies
entspricht der original Markierungsvorschrift, die mir vorliegt. Bei
anderen Fahrzeugen wurde auch einfach eine rechteckige Fläche in
sandfarben unterlackiert, auf die dann in schwarz die Beschriftung
aufgebracht wurde. Hier muß man genau prüfen wie und wann
die Farbgebung erfolgte um den zeitlichen Rahmen einordnen zu
können.
Für mein Fahrzeug muß ich die genaue Beschriftung noch ausknobeln und dann passende Schablonen dafür erstellen.
Da
ich ein Fahrzeug aus der örtlichen Coleman Kaserne bauen
möchte, muß ich die Markierungen der dort stationierten 3.
Spearhead, etc. herausfinden, was nicht so einfach ist, da die genaue
Aufstellung der Panzereinheiten damals geheim war und heute schwer zu
finden ist.
|
 |  | | Zum
Üben der richtige Anfang! Die Laufrollen erhalten unterschiedliche
Farbgebungen. Dabei müssen nicht immer alle Farbtöne
eingesetzt werden! | Die
Wanne ist echte Handarbeit. Lackieren mit der Airbrush ist hier
aufwändiger als von hand.
Zudem wurden die meisten Panzer mit dem
Pinsel getarnt. |  | 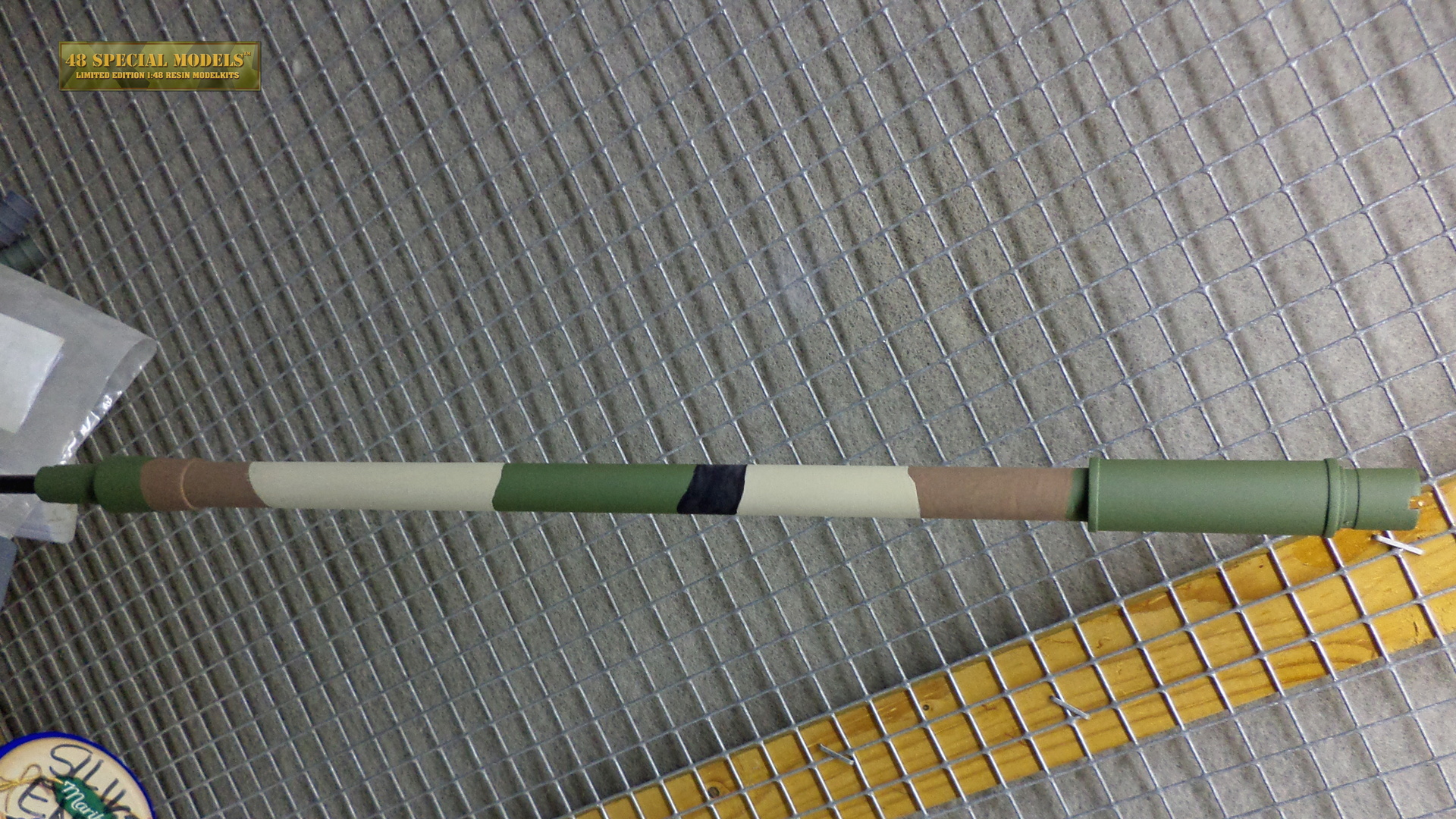 | | Hier fehlt nur noch der schwarze Farbton. | Am Rohr kann man die prozentuale Farbverteilung gut erkennen. | 
| 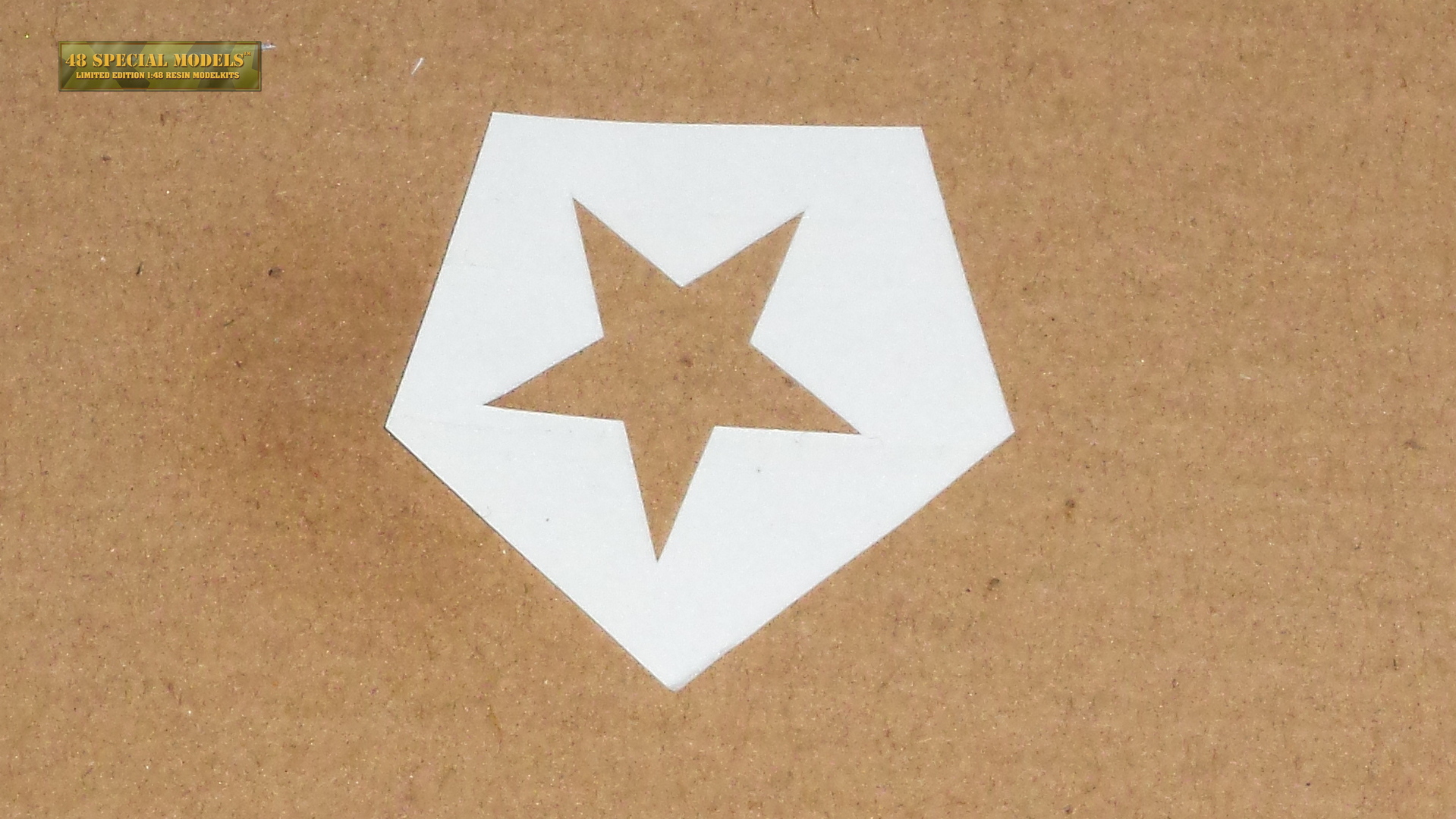 | Die grafische Vorlage. Das Bild hier ist in Originalgröße abgelegt.
Sie können es einfach als Grafik abspeichern und dann nutzen.
| Die Maske für den Stern am Turm. |  |  | | Stern und schwarze Flecken sind lackiert. Es folgt der matte Klarlack. | Von der Seite gut zu erkennen der 25mm hohe Stern. |  |  | | Sicher
verwahrt im Karton. Hier erkennt man die ungleichmäßige
Farbstruktur im Braun und den unterschiedlichen Grad der Mattheit der
verschiedenen Farbtöne gut. | Das Braun ist geradezu fleckig im Vergleich zum grün. | 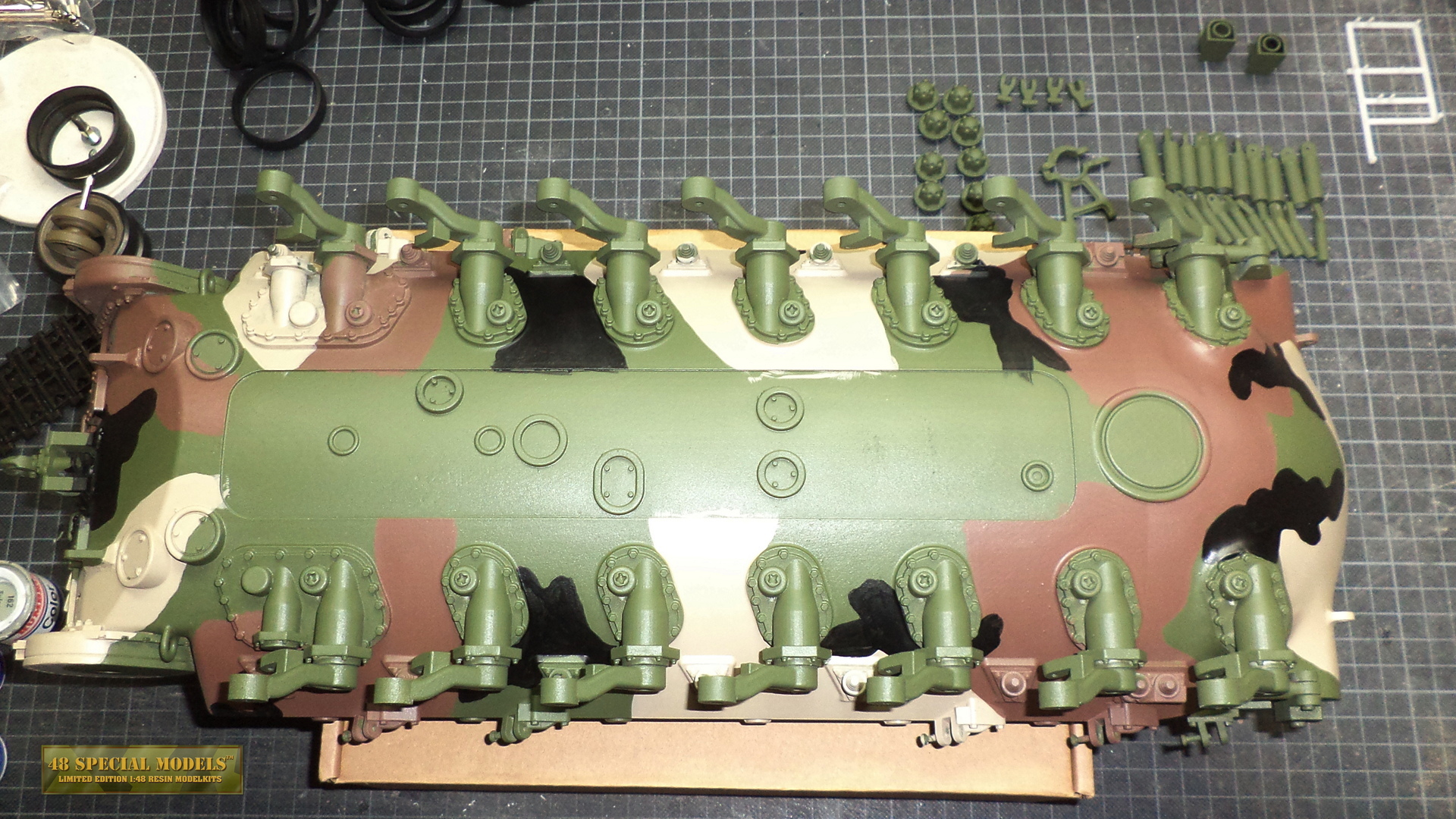 |  | | Dem kann mit einer oder mehreren Lagen Mattlack abgeholfen werden. Hier habe ich einen seidenmatten Glanz gewählt. | Auch der Turm sieht da gleich anders aus. Mal abgesehen von der Beleuchtung, die die Farbtöne sofort verändert! |  |  | Viel Handarbeit auch bei den Laufrollen.
Auch sie wurden abschließend mit Mattlack überlackiert. | Detailarbeit
am Maschinengewehr. Die Halterung hier ist standardmäßig
noch im gerne als NATO-Oliv bezeichneten Dunkelolivgrün gehalten.
Die Stützrollen links sind die Kunststoff Version, die ganz
in Sandfarben lackiert wurden. |  | 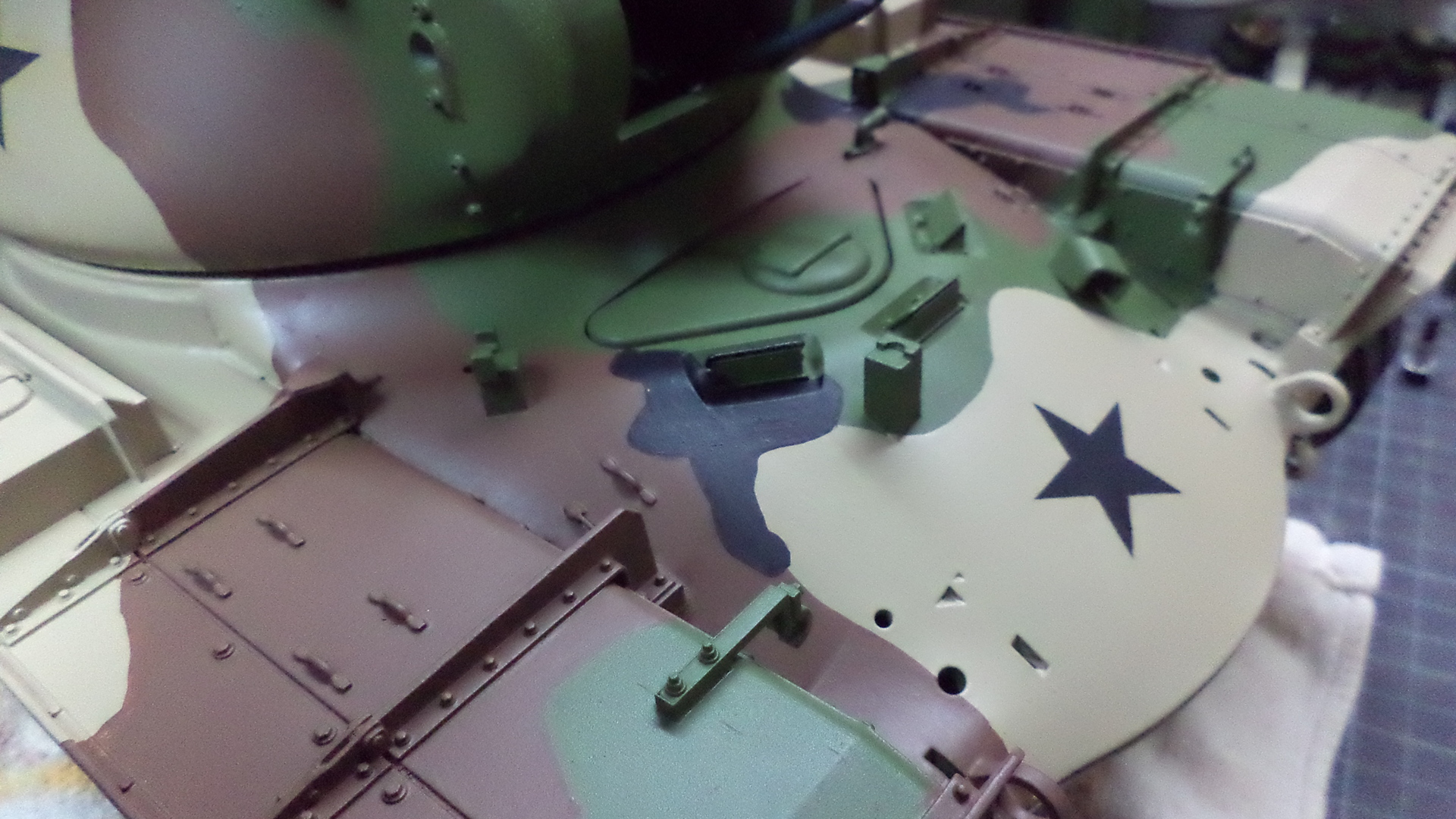 | Die Wirkung der Mattlackierung ist egalisierend.
Sie macht aus verschiedenen Mattstufen eine. | Daher ist es auch gut den Stern schon auflackiert zu haben.
Zudem wird er so geschützt. |  |  | | Der Panzer in der Seitenansicht mit fertigem Anstrich. | Was fehlt sind neben einigen Anbauteilen und der Steuerung nur das Weathering. | 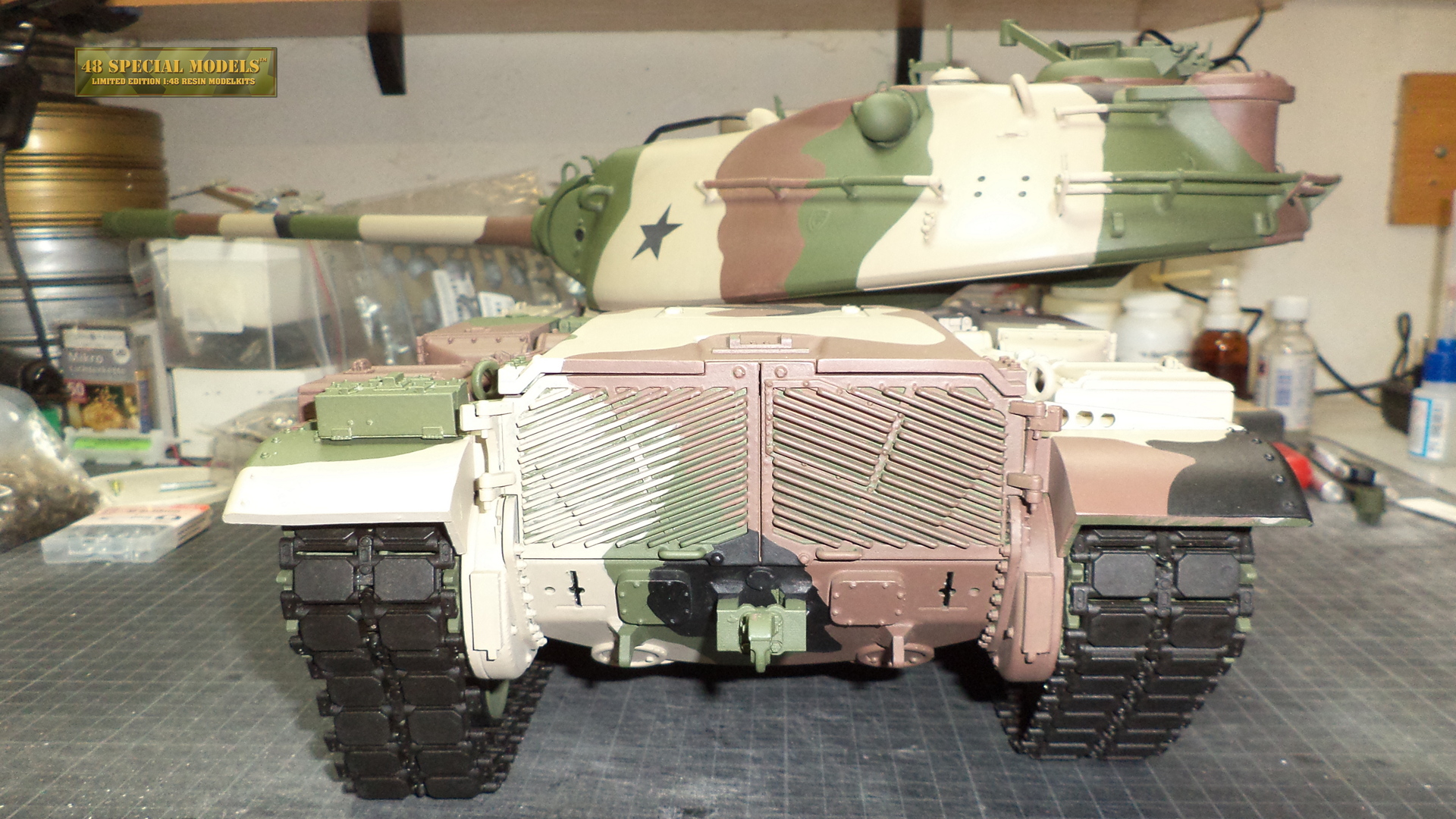 | 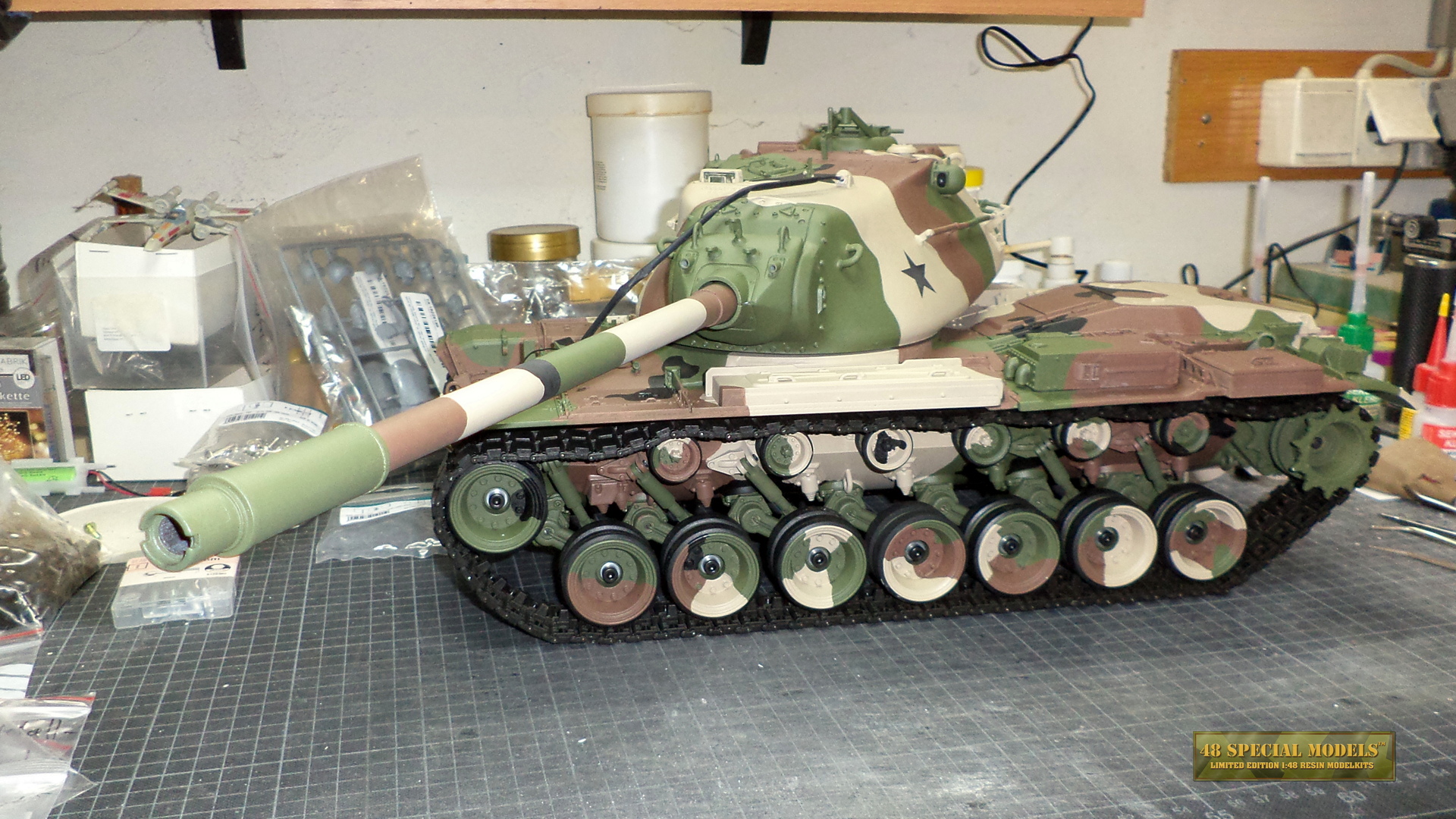 | | Heckansicht, hier noch ohne die Rücklichter und Gebrauchsspuren. | Die im Original 11,4m lange Kanone ist auch am Modell prägnant! |
|
Nach
der farblichen Gestaltung des Tarnschemas sind die Flecken nicht nur
farblich unterschiedlich, sondern auch der Grad der Mattheit ist
deutlich sichtbar nicht identisch. Daher erfolgt eine komplette
Lackierung mit einem Mattlack.
Ich nutzte hierfür den Tamiya
Klarlack, dem die Flatbase in geringer Menge zugesetzt wurde. Um den
gewünschen Mattheitsgrad zu erhalten bedarf es hier einiger Tests,
da der Tamiya Lack leider gerne in Extreme auswandert. So kann es sein,
daß er nach dem Trocknen weiße Ränder bekommt, was auf
zuviel Flatbase Zusatz hindeutet. Hier muß man mit etwas
Klarlackzugabe nachsteuern. Stimmt der Mattheitsgrad, kann
anschließend auf Spritzpistolengängigkeit hin verdünnt
werden.
Alle Außenteile werden mit einer oder mehreren
Schichten gleichmäßig überlackiert. Dann gründlich
24Stunden trocknen lassen!
Auch die Kleinteile wie MG und
Kanister, etc. werden so behandelt. Grund ist einen gleichförmigen
Untergrund für die spätere Effektbemalung/Alterung zu
erstellen.
Daher
auch ein seidenmatter Glanz. Um beim Auftragen von Wash und anderen
Effekten einen besseren Farbverlauf zu erzielen, darf der Matteffekt
nicht zu stark sein. Nachdem die Effekte lackiert wurden, erfolgt eine
abschließende Mattlackierung!
| Laufrollenmontage
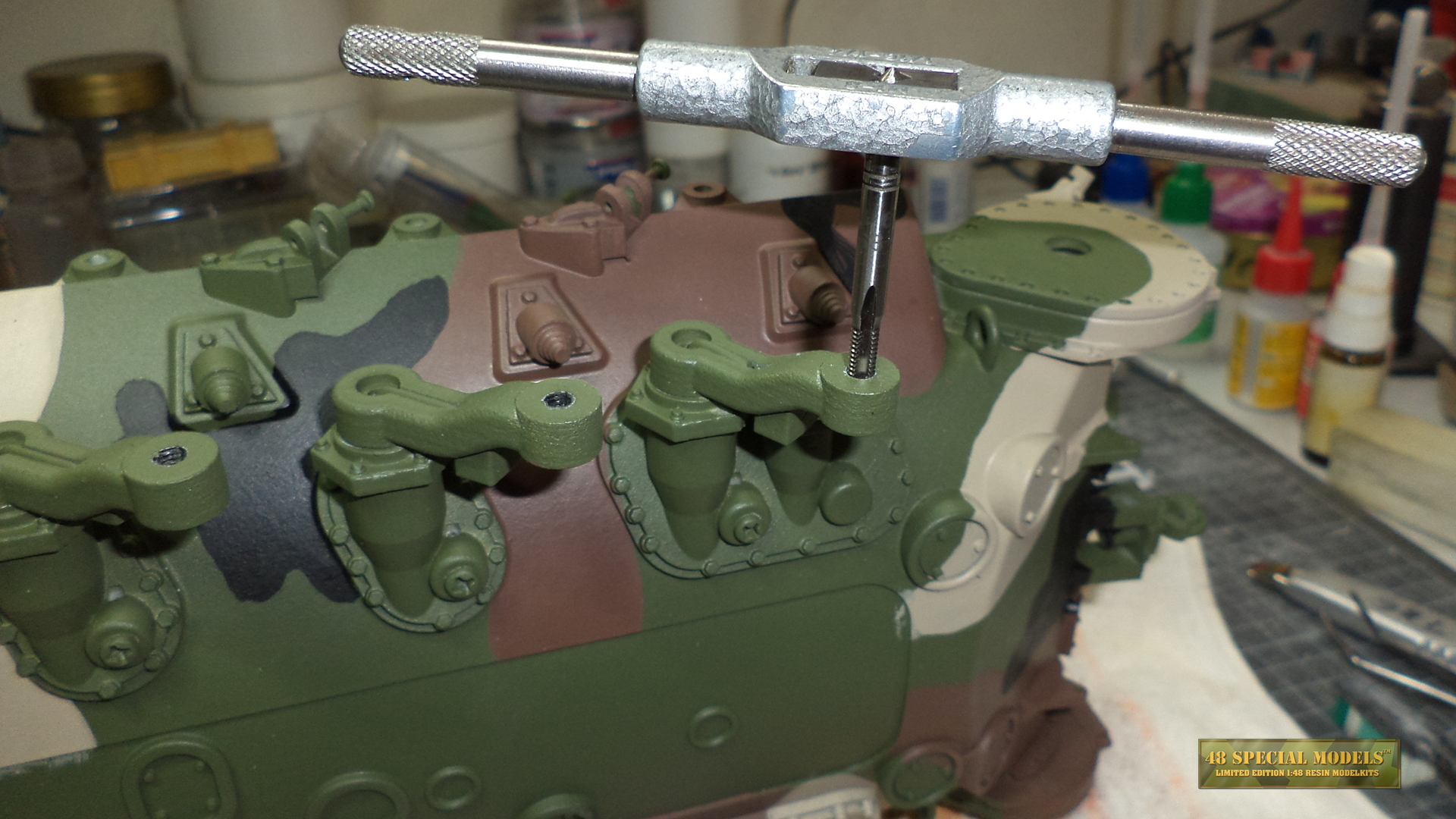 | 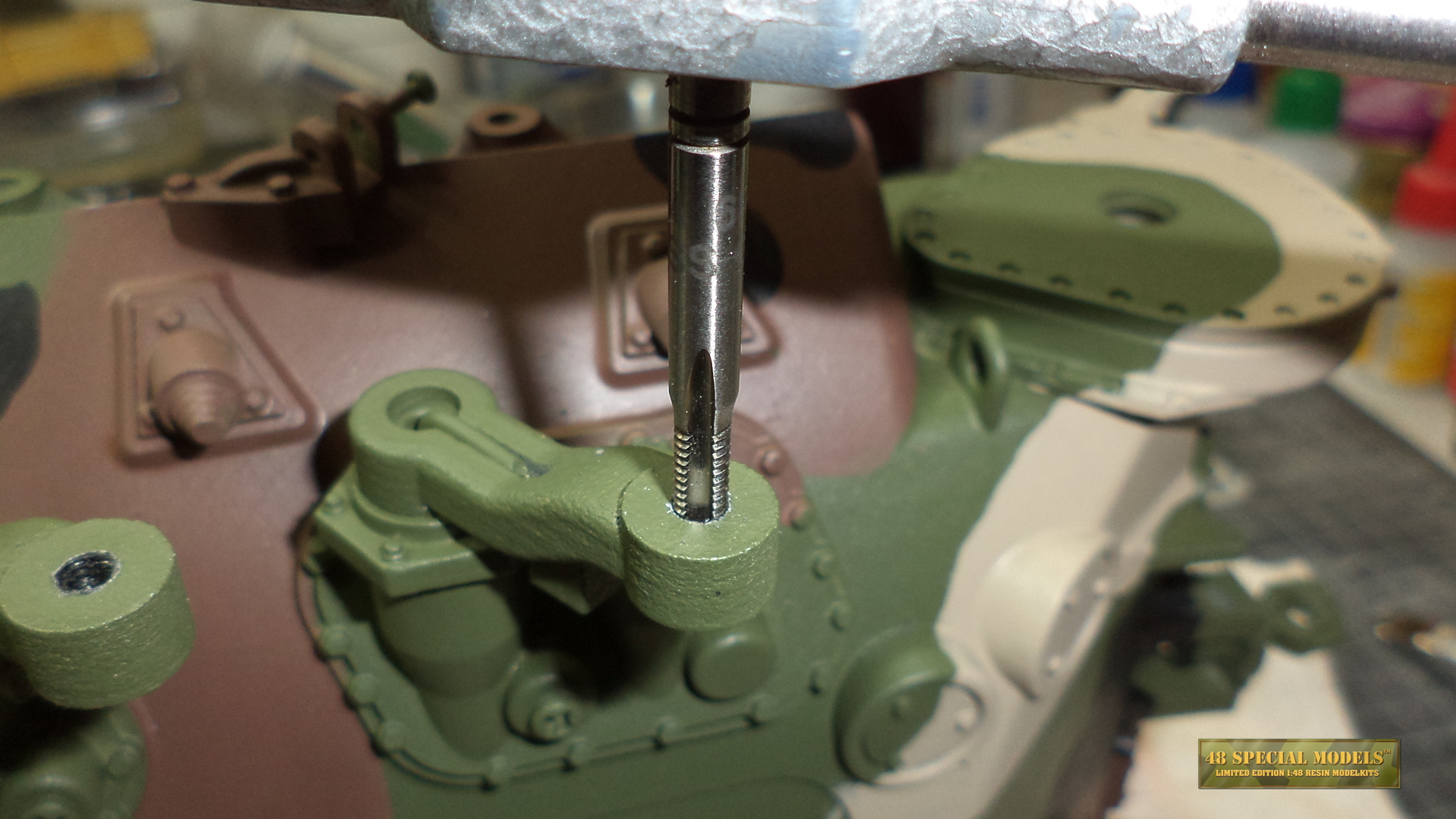 | Mit einem dreiteiligen Gewindebohrerset M4 werden die Gewinde teilgebohrt.
Nur die ersten zwei Bohrer werden genutzt und der Zweite auch nur zu 2/3 der Tiefe. | Das ist wichtig, damit die Schraube später fest sitzt. So muß sie nicht gesichert werden. | 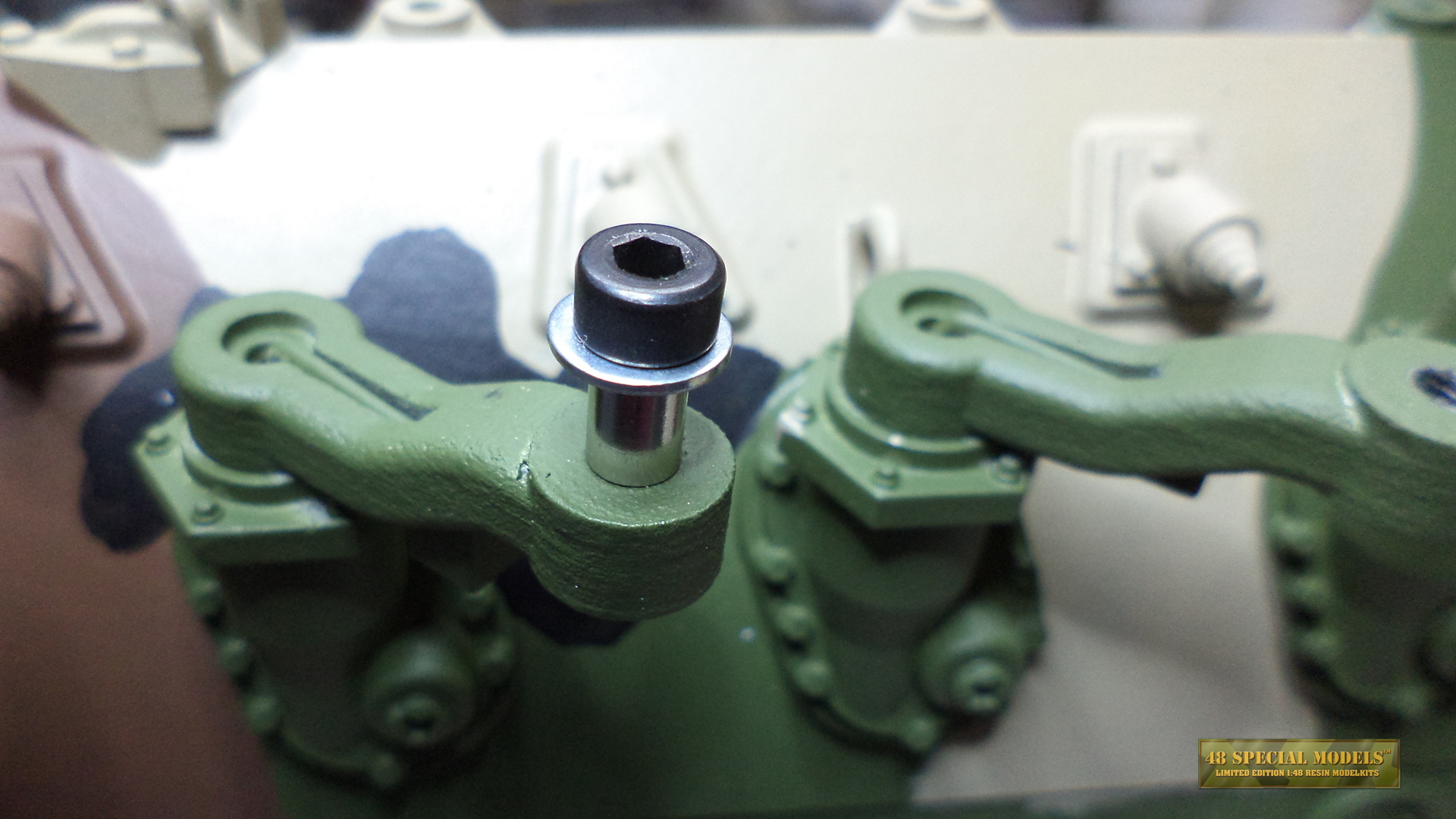 | 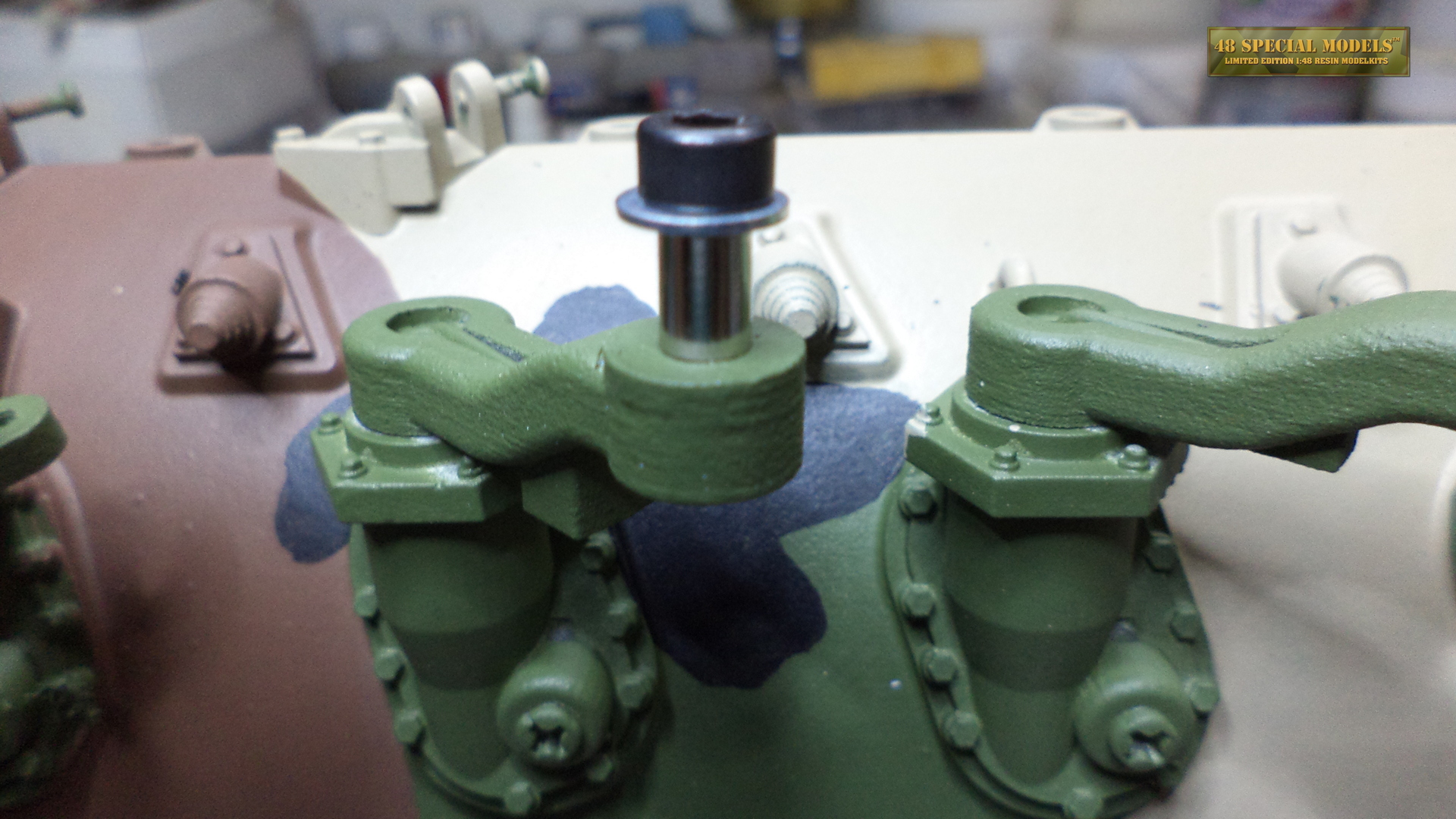 | | Verwendet
wird hier eine M4 x 14mm Innensechskantschraube, mit aufgeschraubter
Hülse, Außendurchmesser 5mm, Länge 7,2mm | Hier
ist nur eine Unterlegscheibe eingebaut. Später werden es zwei
sein, eine direkt am Schwingarm und eine oben unter dem Kopf. So wird
verhindert, das die Kugellager blockiert werden, da 1/10 Spiel bleibt. |  |  | | Vor
den Laufrollen müssen zuerst die Federbeine montiert werden. Erst
dann können die Laufrollen und ganz zum Schluß die
Stützrollen eingebaut werden. | Ansicht
der Motorlagerung innen. Das inner Loch ist 16mm im Durchmesser und
genau so groß das ein Kugellager 16/8 eingepaßt werden kann. |  |  | | Da man die Achse nicht ins Loch bekommt wenn man die Kugellager in die Seitenwand montiert,... | ...bleibt
nur sie direkt auf die Achsen zu schieben. Das ist relativ schwierig
und bedarf etwas nachschleifen der Achse
und ausreichend Öl. |  | 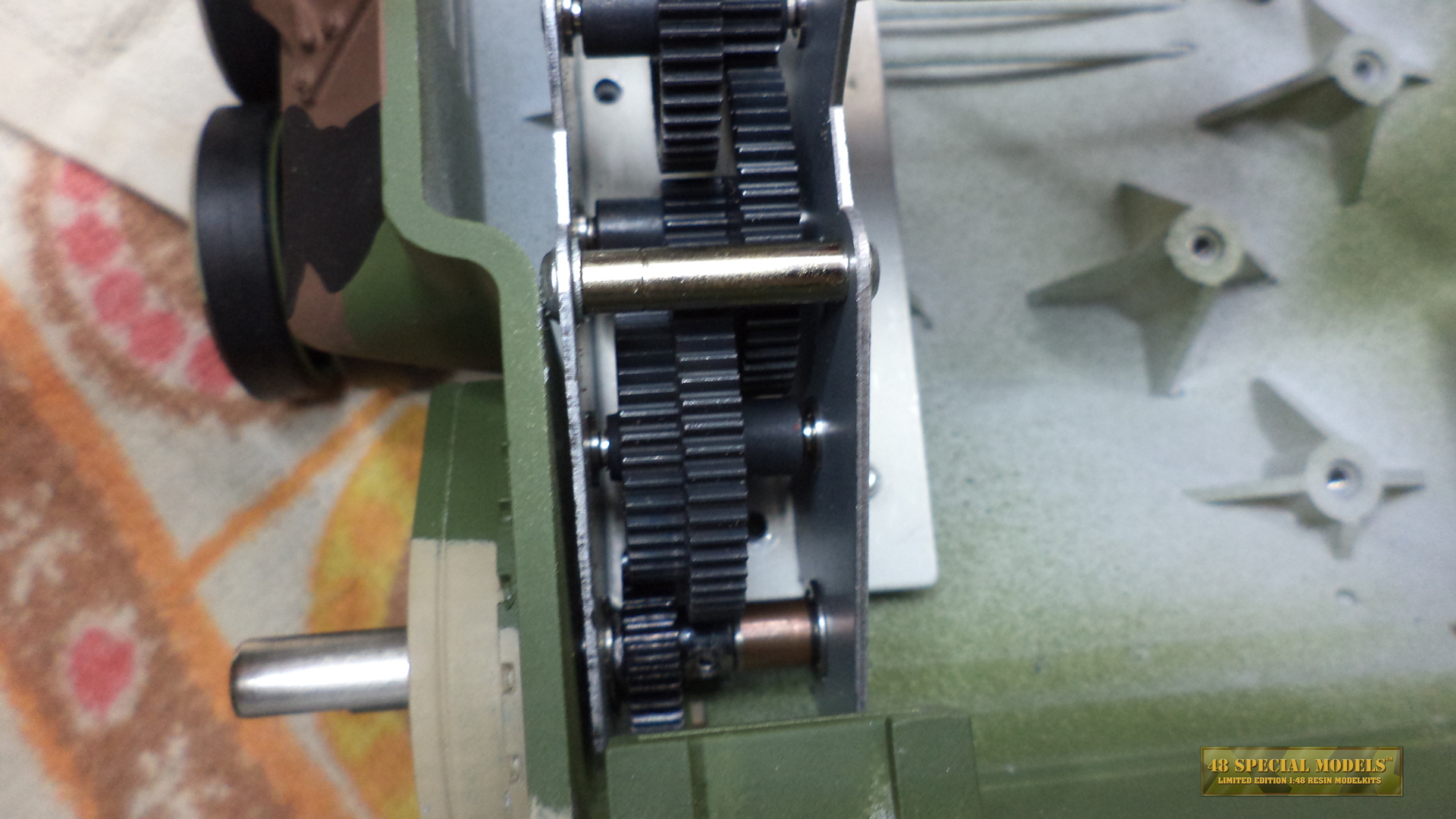 | | Ist das Lager drauf, wird es bis an die Getriebewand geschoben. | Entgegen der Annahme wird der linke Getriebeblock zuerst eingesetzt. Ansonsten bekommt man den rechten nicht rein! |  |  | | Deutlich zu erkennen, die Kette ist zu lang und die Wanne noch zu leicht. | Resultat ist ein verkantetes und abgerissenes Dämpferbein!
Sehr ärgerlich! |
| Um
die Laufrollen montieren zu können bedarf es einiger Vorarbeiten.
So müssen 16 Gewindehülsen mit M4 Innegewinde und 5mm
Außendurchmesser sowie exakt 7,2mm Länge hergestelllt
werden. Dann bedarf es noch je 2 Unterlegscheiben mit 4mm Innenbohrung
und möglichst kleinem Außendurchmesser.
Die
Hülse wird auf eine Innensechskantschraube M4x14mm aufgeschraubt,
nachdem zuvor eine Unterlegscheibe aufgesteckt wurde. Dann kommt die
Laufrolle darüber und es folgt die zweite U-Scheibe. Sind die
Scheiben angedrückt sollte sich die Laufrolle dazwischen frei
drehen können. Ist dem nicht so, eine längere Hülse
herstellen. Das Ganze wird dann auf den Schwingarm geschraubt, der
zuvor mit zwei Durchgängen eines dreiteiligen Gewindebohrersets M4
bearbeitet wurde. Der zweite Bohrer wird dabei nur zu 2/3 tief
eingebohrt, damit das Gewinde nur teilfertig geschnitten ist. Da die
Schwingarme aus Nylon sind, wird die Schraube so einfach ohne weiteren
Aufwand gesichert. Alle Schwingarme und die Umlenkrollenlöcher
vorne müssen so behandelt werden. Bei den Umlenkrollenlöchern
habe ich allerdings einen Sacklochgewindebohrer für den
Maschineneinsatz genutzt. Der schneidet das Gewinde auf nur ca. 1cm
länge komplett. Da die Umlenkrolle vorne an der Bordwand anliegt,
wäre man mit dem anderen Bohrer nicht tief genug gekommen.
Daher dieser Maschinengewindebohrer, den ich mit dem Handteil zu 2/3
eingedreht habe. Das letzte Drittel der Lochtiefe bleibt wieder
ungeschnitten zwecks Selbstarrettierung der Schraube.
Bei
der
Auswahl der Schrauben und Unterlegscheiben sollte nicht vergessen
werden, daß noch die Abdeckkappe darüber passen muß.
Bei den Metallkappen ist das nicht so leicht festzustellen, auch mit
Messen. Hier kann noch ein Problem auftreten, welches zum Auswechseln
der
Schrauben und eventuell der U-Scheiben führen kann.
Auf dem
Bild oben sieht alles schon fast wie ein Panzer aus und der Anstrich
macht auch was her. Die Montage und Fertigung der Hülsen hat mich aber einen ganzen Tag Arbeit gekostet.
Manchmal
muß man etwas überdenken und dann ändern. Hier
mußte ich noch andere Innensechskantschrauben für die Räder
finden, welche mit flachem, abgerundetem Kopf. Da diese im Zuge der
Krise in Deutschland nicht zu finden waren, habe ich sie direkt in China
bestellt. Mit knapp 6 Euro waren sie hier samt Lieferung billiger als
alles was ich sonst im Internet finden konnte, dafür dauerte es
fast 3 Wochen bis sie eintrafen.
Aber sie passen perfekt. Jetzt
können die Abdeckkappen eingepaßt werden.
Ich habe die
Metall- und die Kunststoffkappen, die sich äußerlich
gleichen. Da mir eine aus Metall auf jeder Seite fehlt und dort sowieso
eine Kunststoff Laufrolle eingebaut ist nutze ich hier eine der
Kunststoff Kappen. Auf die anderen Laufrollen und die Umlenkrolle
kommen die Metallkappen, da sie schon Lackiert sind. Diese müssen
aber an der Kontaktkante vom Lack befreit werden, da sie sonst nicht
passen. Jede einzelne mußte ich zudem noch per Hand zuschleifen,
bis sie perfekt saß und nicht abfiel. Erst wenn das Fahrwerk
komplett getestet ist sollte man sie eventuell mit einen Klebepunkt
sichern. Dann bekommt man sie aber nicht mehr ab!
Ich habe es nicht ausprobiert aber möglicherweise passen auch die Kunststoffkappen, dann kann man auch diese verwenden.
Für das Antriebszahnrad wird auf beiden Seiten die mitgelieferte Kunststoffkappe genutzt. Die paßt perfekt.
| Die
Dämpferbeine
Dem Modell liegen die
Dämpferbeine bei. Auf jeder Seite 5 Stück. Die
Dämpfer sind dreiteilig. Oberteil, Spiralfeder innen und
Unterteil. Sie werden oben und unten mit einer Subminiaturschraube
befestigt. Ich mußte erst noch das Loch im oberen Ende auf 2 mm
aufbohren, damit die Schraube frei hindurchpasste.
Leider sind die
Federn etwas dünn und die unteren Beine etwas kurz, so kann es
passieren, das alles nach der Montage wieder auseinanderstrebt, weil
das unbelastete Fahrwerk einen längeren Federweg hat.
Die Kette erweist
sich zudem als eindeutig zu lang. Das Fahrwerk steht noch zu hoch, da das
nötige Gewicht fehlt um es abzusenken und die Dämpferbeine
neigen dazu sich nach außen zu knicken, da sie nicht weit genug
ineinander stecken.
Sind die
Dämpfer erst mal eingebaut, sollte man daher die Wanne auf den
Rädern stehen lassen, wenn man nicht die Federn suchen möchte.
Leider klappte das nicht, nachdem ich die Kette aufgezogen hatte. Es kommt wie es kommen muß. Bei dem
Versuch das Fahrwerk tiefer zu drücken verkantet sich ein
Federbein bevor ich es merke und bricht ab. Ärgerlich da kein
Ersatz beiliegt!
Das bedeutet viel mehr Arbeit, denn jetzt muß ich alle Dämpfer überarbeiten oder gar auswechseln.
Den
einen mußte ich reparieren, durch einsetzen eines neuen Befestigungsflansch
aus PS.
Dazu wurde der gebrochene Teil entfernt und ein Schlitz in die
Hülse gefeilt. Das ist etwas Feinarbeit geht aber gut mit einen
feinen Raspelfeile für Kunststoff. Aus einer 2mm PS-Platte habe
ich dann einen passenden Streifen geschnitten und ein 2mm Loch
hineingebohrt. Das geht einfacher bevor man den Streifen in den
Rohrteil einpasst. Der Streifen wird dann, ausgehend von der Bohrung,
passgenau zugefeilt. Dabei wird ein ca. 2-3mm langer Überstand
ausgespart, der im Rohrstück verschwindet. Der Rest wird nur grob
bearbeitet, da er nach dem einkleben besser Bearbeitet werden kann. Das
Teil dann in das Rohr einsetzten und mit dickflüssigem
Sekundenkleber von innen und außen ankleben. Zwischentrocknen
lassen und anschließend mit Füllstoff und Kleber den Wulst
an der Seite der Haltelasche auffüttern. Alles über Nacht
trocknen lassen.
Am nächsten Tag kann dann die Rundung an
beiden Seiten ausgefeilt werden und die PS-Platte in Länge und
Breite abgefeilt werden bis sie dem Vorbild entspricht. Dann
grün lackieren und die Feder einkleben. Fertig ist das Federbein.
In
der Zwischenzeit wurde die Kette um 2 Glieder auf jeder Seite
gekürzt. Der Effekt ist beachtlich, dennoch sollte beim Einbau
vorsichtig gearbeitet werden. Die Federbeine müssen erst manuell
in Position gebracht werden, bevor die Kette geschlossen wird. Oder man
schließt die Kette erst und entfernt die äußere
Hälfte des Zahnrads. Setzt dann die Kette auf und richtet die
Federbeine aus. Anschließend wird das Zahrad wieder
zusammenmontiert.
Da die vordere Umlenkrolle gleichzeitig auch die
Spannrolle ist wird die Kette nun automatisch so stramm gehalten, das
die Federbeine nicht mehr herausfallen können.
Bei
der Montage der Kette zeigte sich, daß das Antriebszahnrad zu dicht an
der Wanne sitzt. Es fehlen ca. 1-1,5mm damit es in der Flucht mit den
Laufrollen ist. Das kommt durch die von mir eingefügte zweite
U-Scheibe an den Laufrollen. Offensichtlich war die ursprünglich
nicht so geplant. Dennoch sind sie sinnvoll und geben der Kette etwas
mehr Abstand zur Wanne.
Um das Antriebszahnrad um den gut 1 mm nach
außen zu verschieben, schneide ich eine U-Scheiben passend zu, so
daß sie zwischen Achse und Zahnrad passt. Nun kann der inner Teil
des Antriebsrades aufgesetzt werden, dann wird die Kette eingelegt und
anschließend der äußere Teil angeschraubt.
Man
kann natürlich auch dünnere Unterlegscheiben für die
Lufrollen einsetzten! Die sind aber gerade nicht greifbar.
Jetzt
können die Stützrollen farblich zugeordnet und in die
dafür vorgesehenen Löcher gesteckt werden. Noch nicht
verkleben, falls noch nachjustiert werden muß.
| Motor/Getriebeeinbau
Die
Getriebe mit den angebauten Motoren einzubauen ist eigentlich einfach,
sollte man denken, aber weit gefehlt. Zuerst muß nämlich
noch ein Kugellager (nicht im Lieferumfang) auf die Antriebswelle, das eigentlich in die
Öffnung in der Wanne gehört. Da man die Welle aber nur
einführen kann, wenn das Lager auf der Achse ganz bis an das
Getriebe geschoben ist, beginnt der Spaß mit dem aufsetzen des
Kugellagers. Alle Gleitflächen wurden gründlich gereinigt und
geölt, aber dennoch bewegte sich das Kugellager kein Stück
über den Anfang der Welle hinaus. Grund dafür war die
Vernickelung, die am Wellenende nur wenige hundertstel Millimeter dicker
ist. Nach schleifen mit 1200er Schleifpapier und nachpolieren mit einem
Tuch und Öl passte dann alles.
Das Loch in der inneren
Wannenseite ist eigentlich exakt so groß, daß man das
Kugellager hineindrücken kann. Durch die Lackierung hatte sich
hier aber Farbe abgesetzt, die erst entfernt werden mußte.
Anschließend
begann das Kunststück die beiden Getriebe mit Motor in den engen
Motorraum einzuführen und dabei die Achse samt Kugellager in das
dafür vorgesehene Loch zu drücken. Es war nicht einfach und
brauchte etwas Zeit, bis ich herausfand, daß man, entgegen meiner Vermutung
mit dem tieferliegenden Motor rechts zu beginnen, man den linken
Getriebeblock mit dem obenliegenden Motor zuerst einführen
muß. Auf halbem Weg muß dann der rechte Block eingesetzt
werden, so daß man ihn unter dem oberen Motor noch hindurch bekommt.
Hört sich kompliziert an, ist es auch!
Denn das Getriebe
hat auch eine Basis und die ist breiter als der Rest und muß um
den gegenüberliegenden Motor und den ganzen Rest herum lawiert
werden. Irgend wie geht das aber. Zuerst wird dann das linke Kugellager
samt Achse eingedrückt, während der rechte Getriebeblock noch
unbefestigt auf die gleiche Prozedur wartet. Sind beide Kugellager in
der Wannenwand verschwunden, flutscht der Rest fast von alleine in
Position.
Die Getriebe werden soweit Richtung Wannenwand geschoben, bis das Lager in selbiger verschwunden ist und die Löcher der
Grundplatte sich mit den Befestigungspunkten in der Wanne decken. Nun
noch anschrauben. Dabei mindestens eine Schraube mit einer
Sprenngscheibe sicher, damit sich der Motorblock nicht locker
rütteln kann.
Hinweis:
Der Aufwand mit den Kugellagern ist meiner Meinung nur nötig, wenn
Metalllaufrollen und eine Metallkette genutzt werden. Bei
Kunststoffketten und -rollen sollte es auch ohne diese zusätzliche
Lagerung keine Probleme geben!
|
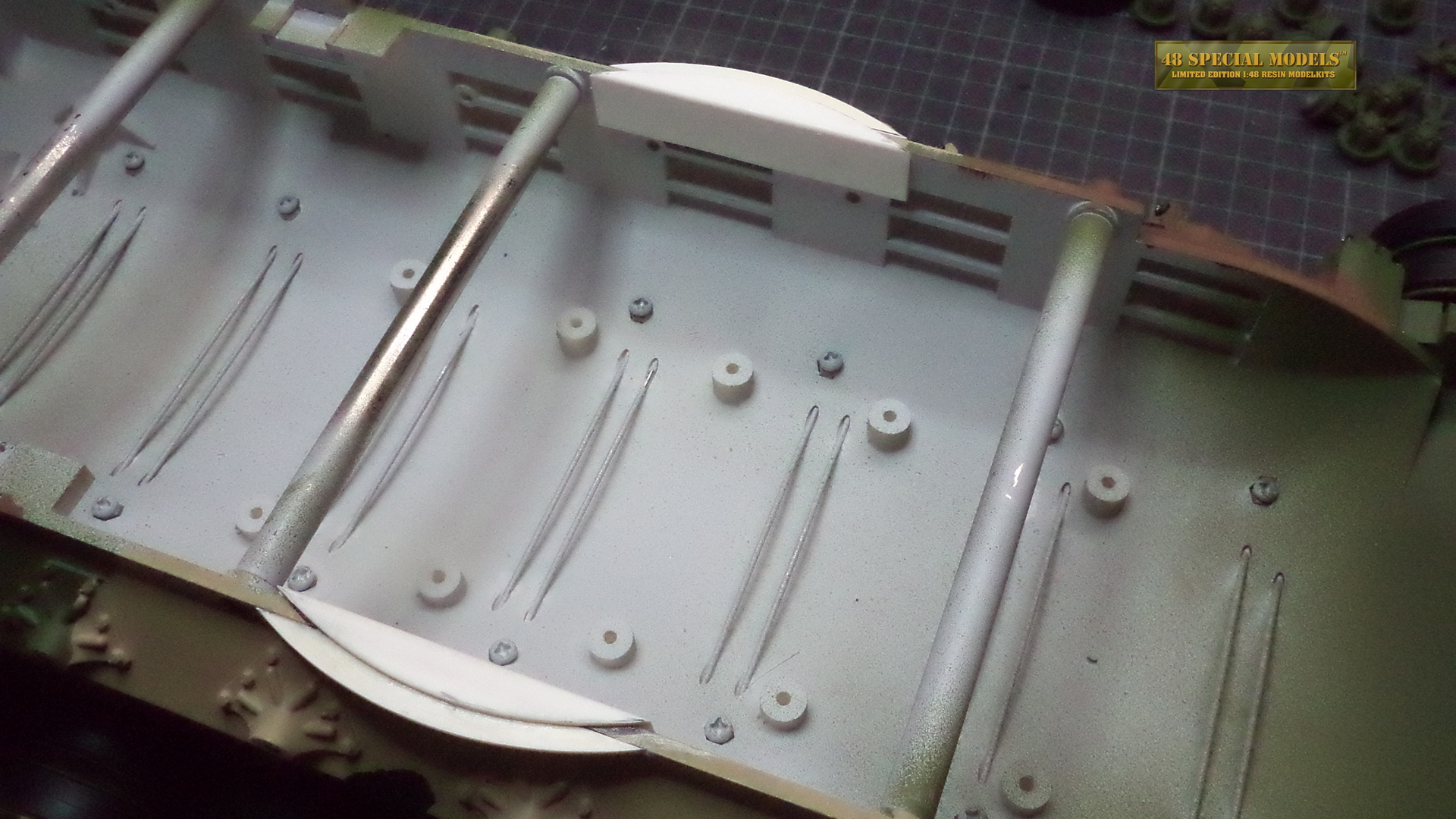 |  | | Im Turmbereich befindet sich eine Lücke die geschlossen werden muß. | Aus
einen PVC-Winkelstück habe ich mir ein passendes Teil gefertig,
welches von innen die Rundung abdeckt. Der Winkel darf dabei die
Löcher für die Stützrollen nicht abdecken! |  |  | | Von
außen wurde ein passender, dünner Polystreifen
dagegengeklebt, um die noch bestehende Lücke staubdicht zu
schließen. | Die Kette ist eindeutig noch zu lang, aber es sieht schon stark nach Panzer aus! |  | 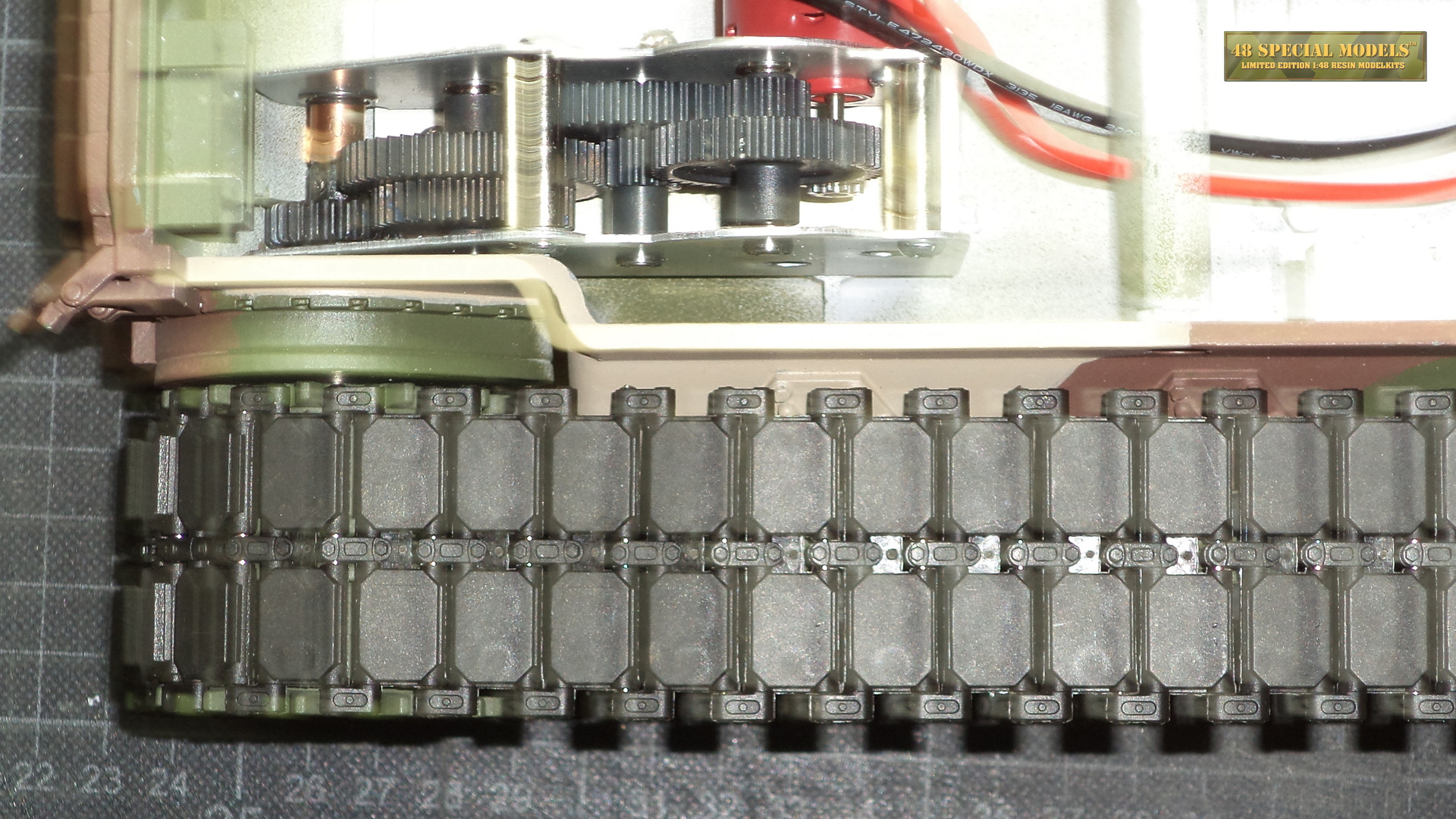 | Antriebsrad und Laufrollen müssen in einer Line liegen,
sonst klemmt die Kette! | Notfalls mit Distanzscheiben unterfüttern bis es paßt. |
| Die Lücke am Turm
Unter
dem Turm, an der Oberwanne gibt es eine Lücke in der
Kettenabdeckung, durch die im Fahrbetrieb Staub oder Dreck eindringen
kann. Am Original ist hier eine Platte verschweißt.
Um Ober- und
Unterwanne weiterhin problemlos trennen zu können gibt es nur zwei
Möglichkeiten. Erstens einen Streifen von außen, unten gegen
den Turmring der Oberwanne kleben. Dabei bleibt aber ein Spalt zwischen
Unterwanne und dem angeklebten Streifen, der nicht geschlossen werden
kann, ohne das er beim Abheben der Oberwanne Probleme macht.
Die zweite
Lösung entspricht meiner Wahl. Ich habe ein Stück
PVC-Winkelleiste zugeschnitten, den Kreisausschnitt der Turmrundung
darauf übertragen und ihn, wie im Bild oben, so eingepaßt, das
er die Löcher für die Stützrollen nicht verdeckt. Da
diese von innen verklebt werden müssen, sollte man das vermeiden.
Den
Winkel habe ich dann von innen in Position geklebt. Anschließend
erstellte ich einen Kreisausschnitt, der sich mit der
Turmunterseite deckt
und von unten gegen den Winkel geklebt wird. Dabei steht dieses Teil
soweit über, das kein Schmutz mehr eindringen kann.
Abschließend
wird an der Außenseite, im Winkel noch eine Schweißnaht
erstellt und alles farblich noch an die Wannenfarbe angeglichen.
Nun
kann die Oberwanne einfach abgehoben werden. Auch der Einschub in den
Halter in der Mitte wird nicht behindert. Allerdings hätte man
diese Stelle auch beim Drucken gleich schließen können. Ein
Punkt der überarbeitet gehört!
Beim
Aufziehen der Kette zeigt sich, daß diese sehr nahe an dieser Abdeckung
vorbeigeführt wird und in manchen Fahrsituationen
möglicherweise schleifen könnte. Das sollte man prüfen
und gegebenenfalls ändern.
| Figurengestaltung
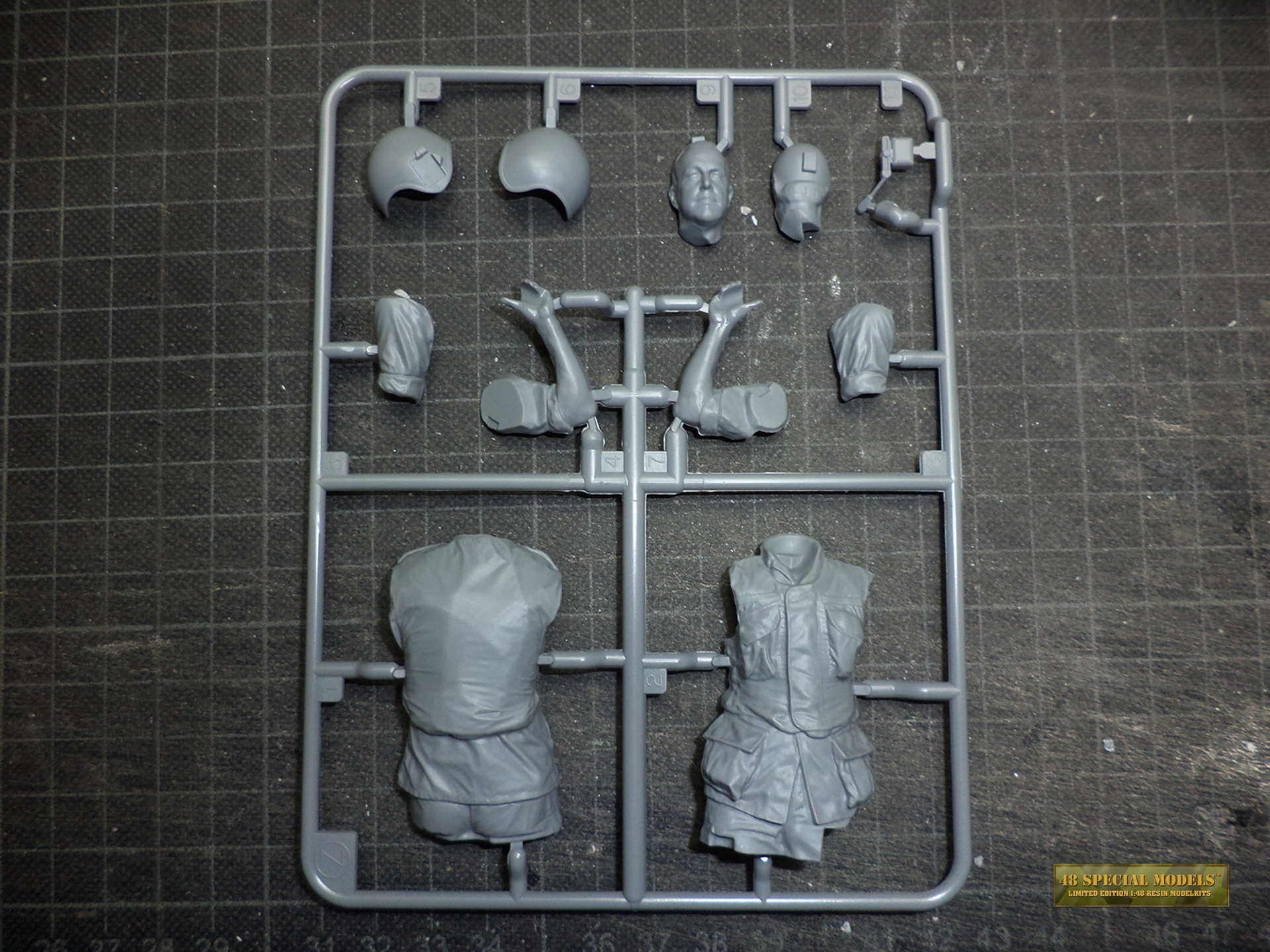 | 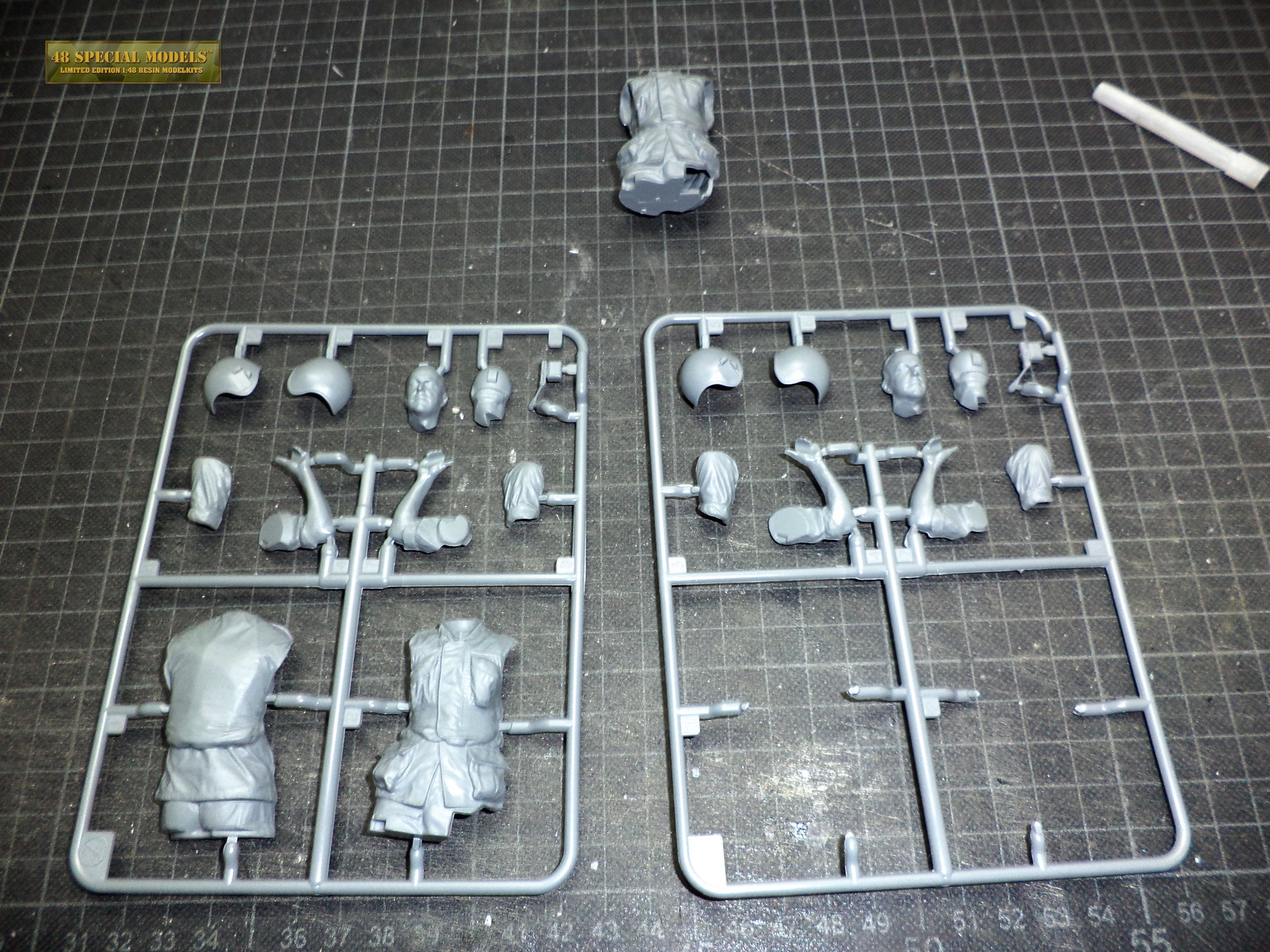 | Das Figurenset stammt aus dem M551 Sheridan Bausatz von Tamiya.
Der einzige erhältliche mit Fahrer/Kommandantenfigur aus den 1970ern. | Tamiya
hat glücklicherweise eine gute Ersatzteilversorgung.
Über die
habe ich mir die letzten zwei verfügbaren Spritzlinge der Figur
besorgt. |  |  | | Eigentlich hat die Figur nur eine Kopfhaltung. Im Text unten steht wie man das schnell ändert. | Auch die Arme gibt es nur in einer Position, daher muß amputiert werden. |  |  | | Testsitzen im Panzer. Die innen angebrachte Wanne paßt genau für diese Figur. | Mit
dem oberen Turmluk ist es nicht so einfach. Die Figur würde bis
zum Gürtel in der Öffnung stecken, leider hat er aber zu
volle Taschen. |  |  | | Ob ich ihm nur die Taschen leer oder gleich den Unterleib amputiere habe ich noch nicht endgültig entschieden. | Derweil wurden dem Fahrer die Arme gerichtet, so das sie ein nicht vorhandenes Steuer halten. |  |  | Nur der rechte Arm brauchte eine Unterfütterung.
Der linke Arm konnte mit Sekundenkleber gefüllt werden. | Kommandant und Fahrer im vergleich. Auch wenn es so wirkt, der Oberkörper ist unverändert bei beiden Figuren. | 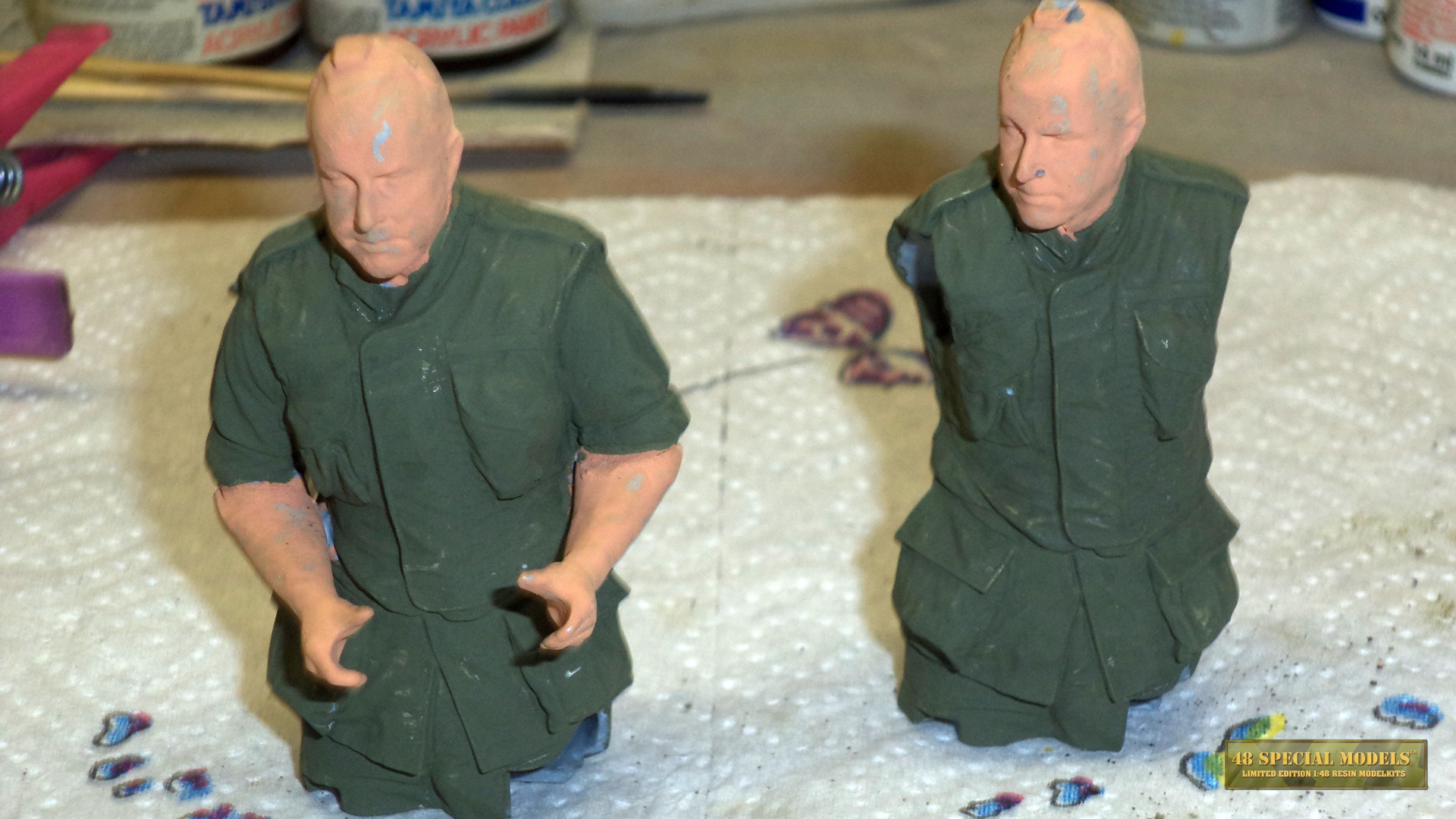 |  | | Der noch raue Grundanstrich wird nochmals wiederholt bis er deckt. | Anderes Licht ander Farbe! Hier ohne Blitz fotografiert. |  |  | Die Helminnenseite sieht man nur im vorderen Teil,
dennoch sollte man die Innenseite bemalen. | Die Außenseite erhält den Grünton der auch am Fahrzeug verwendet wird. Hier aber als Enamel Farbe. |  |  | | Um den Kommandanten der Luke anzupassen benötigt es etwas Epoxidknete um den Unterleib zu verlängern. | Beim Anpassen stellte sich heraus, das die Figur zu hoch saß um das MG zu bedienen, also Messer raus und amputieren! |  |  | | Sieht brutal aus, ist es auch. Der meiste Kit mußte wieder weg. | Nun paßt die Figur und kann das MG bedienen. |  |  | | Die abgetragenen Stellen werden mit etwas neuem Epoxidkit optimiert... | Anschließend werden beide Figuren fertig bemalt. |  |  | | Um die Figur zu befestigen benötigt man eine Plastikscheibe mit 40mm Durchmesser. Der Strich zeigt an wo die Figur endet. | Den Überstand wegschneiden und die Scheiben von oben in die Luke einlegen.
|  | 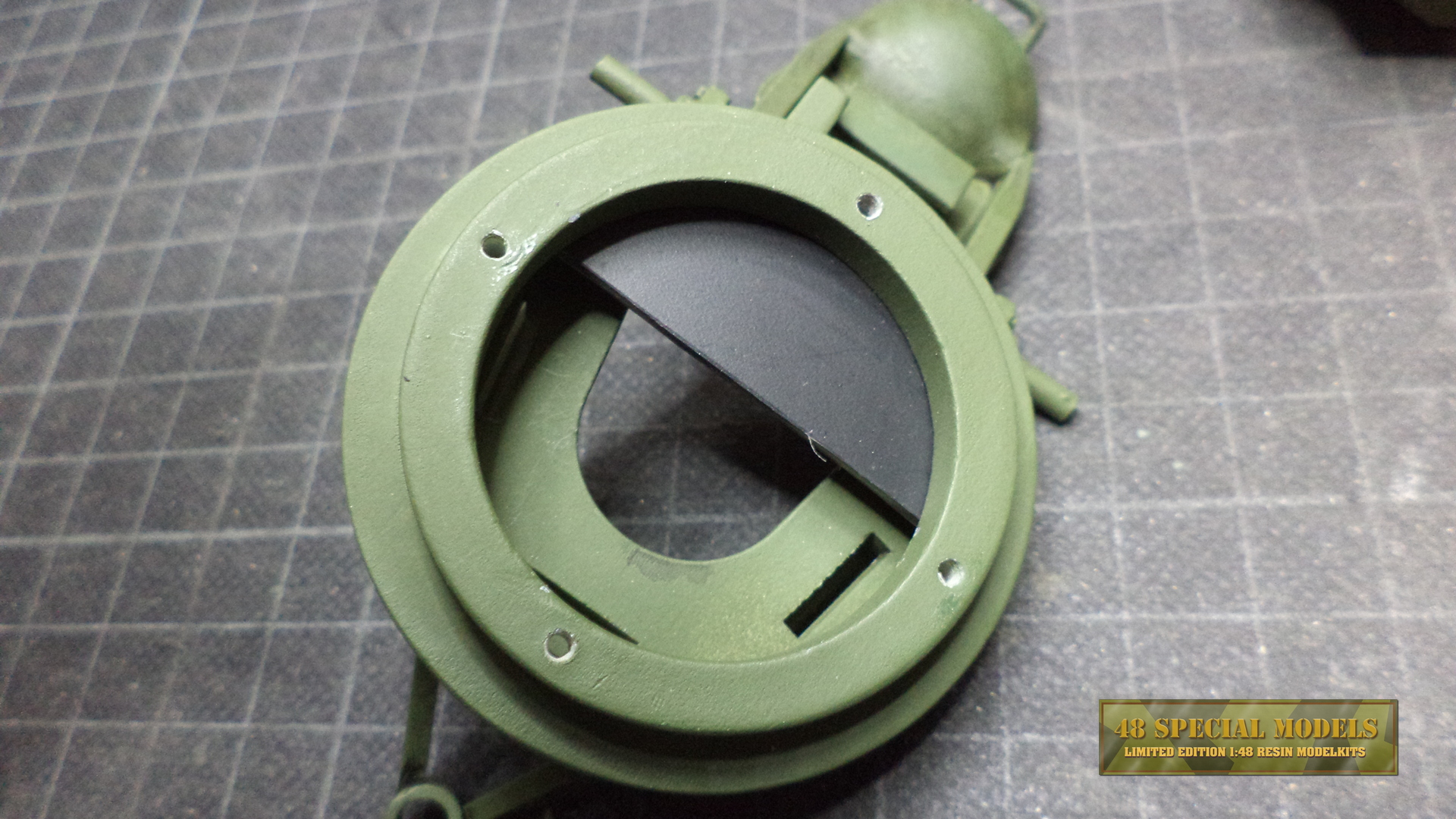 | | So sitzt die Scheibe korrekt. Nicht ankleben! | Von unten sieht man die Einschübe der Winkelspiegel.
Diese dürfen nicht verdeckt werden! |  |  | | Figur von oben anhalten, mit MG in Position, und von unten ein 2mm Loch durchbohren. | Passende Schraube rein, fertig! |  |  | | Aus einem 10 x 2mm Streifen Plexiglas/PS oder PC werden die Winkelspiegel geschliffen. | Das obere Ende wird im 45° Winkel abgeschliffen, dann poliert und eingepasst. | 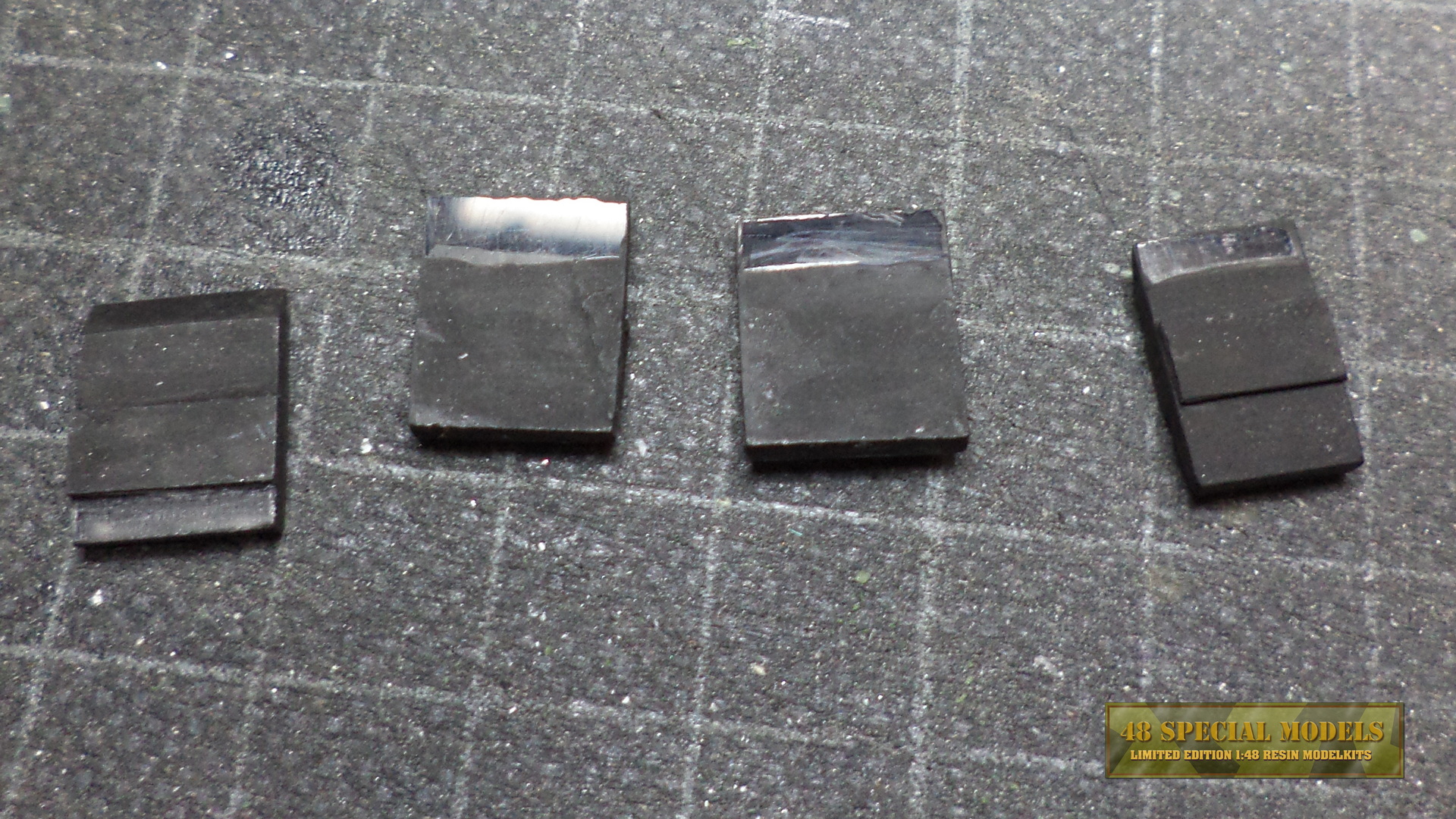 |  | Die
Winkelspiegel sind unterschiedlich breit und lang. Sie werden an der
Spiegelfläche erst Silbern dann von außen Schwarz lackiert.
Die aufgeklebten PS-Streifen verhindert das der Spiegel zu weit eingeschoben wird. | Der eingesetzte Winkelspiegel wirkt wie echt! |  |  | | An allen Seiten ... | perfekt eingepasst... |  |  | | ... und mit einem Tropfen Kleber von innen gesichert. | Der Winkelspiegel in Turmluk kann auch ausgebaut werden. |  |  | | Nicht gut zu erkennen aber auch hier wurde ein Winkelspiegel eingebaut. | Viel ist vom Panzerfahrer nicht übrig wenn er in seinem "Loch" verschwunden ist. |  |  | Dennoch hat er Rangabzeichen und Einheitsabzeichen bekommen.
Die stammen von M4A3 Panzerfahrer und wurden mit
Abziehbilderweichmacher behandelt damit sie sich den Falten anpassen. | Leider
gibt es bei den Einheitsabzeichen immer nur zwei mit der gleichen
Nummer, aber mit etwas Dreck läßt sich das gut
überdecken. |  |  | Der hier gehört zur 4. Pz.Div. Spearhead.
Ja,
ich weiß das der M103 A2 nur von den Marines gefahren wurde. Aber
meiner kommt aus meiner Heimatstadt und hier war die 2. Brigade "Iron
Brigade" stationiert und die hatten Schulteraufnäher der 3. Panzer
Division.
Siehe unten rechts. | O.K.
die Patches und Rangabzeichen sind nicht aus den 1970ern. Aber in
Ermangelung der passenden waren die die am nähesten dran waren. | 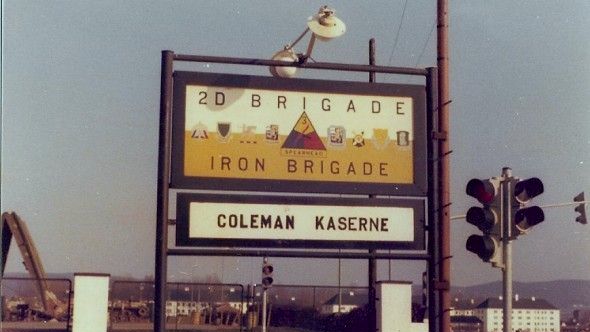 | 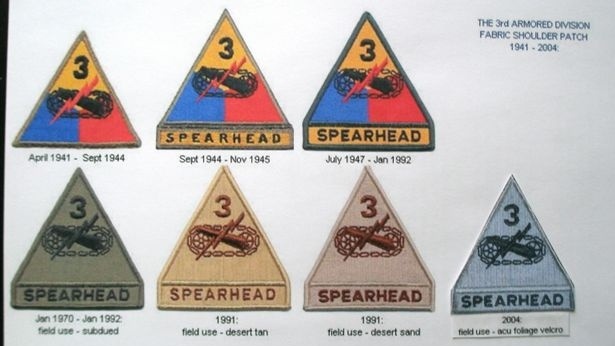 | Dieses Bild aus dem Internet zeigt das Schild am Haupteingang der Coleman Kaserne in Gelnhausen Anfang der 1970er.
Beachte die ausgefahrene M48 Brücke links im Bild. | Auch im Internet, auf der Seite der Einheit zu finden die Patches seit 1941 bis 2004.
Der Unterschied zwischen 1941 und 1970 liegt nur in der Unterschrift.
Für
den Feldgebrauch wurden ab 1970 die grünen Patches unten links
verwendet. Die sind aber als Abziehbild noch nicht zu bekommen. |  |  | | Der Luke fehlt jetzt nur noch der Griff zum schließen | Ansonsten macht der Kommandant schon eine gute Figur. |
| Ein
Panzer wie der M103 hatte 5 Besatzungsmitglieder, von denen man
entweder keinen oder mindestens zwei zu sehen bekam, wenn sich das
Fahrzeug bewegte. Das waren der Fahrer und der Kommandant.
Nun
stammt dieses Fahrzeug aus der Zeit von ca. 1960-1975, dem sogenannten
Kalten Krieg und leider sind aus diesem Zeitraum nur wenige Figuren im
Maßstab 1/16 zu bekommen. Genau genommen gibt es nur eine und die
entspringt dem M551 Sheridan von Tamiya. Seine Besonderheit ist der
Panzerfahrerhelm, den es nur in diesem Zeitraum gab und der aus gutem
Grund schnell wieder abgeschafft und durch ein besseres Modell ersetzt
wurde. Ich kann das bestätigen, denn ich hatte mal einen dieser
Helme und bequem ist anders.
Da es sehr wenige Panzermodelle aus der
Zeit nach 1945 als 1/16 RC oder Standmodell gibt, bisher jedenfalls und
die Industrie gerade erst anfängt für die WWII Modelle die es
schon gibt und die demnächst erscheinen Figuren zu produzieren, hat
man kaum Auswahl. So bleibt einem nur eine andere Figur umzugestalten
oder man besorgt sich den Kommandanten aus dem Sheridan Kit. Nun ist
dieses Modell nicht ganz billig, selbst als reines Standmodell. Ich
habe zwar beide, aber da ich die Figur für diese Fahrzeuge brauche
und eigentlich noch zwei weitere, kann ich sie nicht diesen
Bausätzen entnehmen.
Nun gehört Tamiya zu den Firmen die
einen guten Kundendienst haben, dafür sind sie halt etwas teurer,
aber das bedeutet auch, das man die Spritzlinge aus diesen RC-Modellen
einzeln beim Händler oder Tamiya direkt nachbestellen kann. Das
macht man normalerweise nur um Ersatz für beschädigte Teile
zu erhalten, aber man kann es auch nutzen um, wie hier eine
zusätzliche Figur zu bekommen. Tamiya hätte natürlich
auch auf die Idee kommen können einen eigenständigen Figuren
Satz anzubieten, wie es derzeit beim M4A3E8 Sherman von AHHQ der Fall
ist, aber vielleicht kommt das ja noch.
Über das Internet
habe ich mir Händler gesucht, die dieses Ersatzteil noch am Lager
hatten. Es gab glücklicherweise einen Kollegen, der noch genau 2
Figurensätze hatte und die habe ich auch gleich bestellt.
Bei
einem anderen Kollegen konnte ich zudem noch einen der
Glasteilespritzlinge ergattern, von dem ich gerne mehr geordert
hätte, aber es gab nur noch den einen. Wofür? Dazu
später mehr.
Warum man zwei Figuren benötigt ist
eigentlich so offensichtlich, das ich mich immer wieder Frage
warum die Hersteller nur eine Figur mitliefern? Wenn der Kommandant aus
der oberen Luke schaut, tut das in der Regel auch der Fahrer, denn der
sieht so besser und weiß wenn der Kommandant oben herausschaut
ist keine Gefahr im Verzug. Bei Beschuß verschwindet
nämlich der Kommandant als erster! Die beiden Kanoniere lassen
sich nur blicken wenn es schönes Wetter hat und man auf der
Landstraße eine Ausflugsfahrt zum nächsten Manövergelände macht! Also immer zwei Figuren oder keine, dann aber auch die Luken dicht!
Nun
ist der Kommandant des M551 Sheridan in einer Haltung vorgegeben, in
der er das M2 MG abfeuert oder zumindestens mit beiden Händen
hält. Das ist für einen Fahrer nicht so geschickt, da die
Hände hoch vor der Brust gehalten werden. Auch schaut der
Kommandant interessanterweise nicht in Schußrichtung, sondern
leicht nach rechts, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Für den
M103 müssen daher beide Figuren umgebaut werden. Der Fahrer
muß nach vorne in Fahrtrichtung sehen. Wer viel Zeit und Geduld
hat, kann ihn natürlich auch den Kopf ferngesteuert mit der Fahrtrichtung drehen
lassen. Das sieht bestimmt klasse aus, ist aber ein wenig mehr Aufwand
als ich beabsichtigt habe. Daher richte ich den Hals so zu, daß er
geradeaus schaut. Dazu muß rechts etwas Hals weg und der
entstehende Spalt links muß aufgefüllt werden. Wie schon bei
den Schweißnähten hilft hier Sekundenkleber und
Füllmittel. Zuerst den Kopf in der neuen Haltung fixieren und
anschließend den Spalt mit Klebstoff und Füllmittel
auffüllen. Geht sehr schnell und braucht wenig Nacharbeit, wenn
man sorgfältig arbeitet. Sieht dann aus als wäre es immer
schon so gewesen und so soll es ja sein.
Die Arme des Fahrer sind
wie gesagt zu hoch und müssen am Ellenbogen amputiert werden. Auch
wenn man sie eigentlich nicht sieht, klebe ich sie aber in der
korrekten Haltung wieder an, ich will den armen Kerl ja nicht
verstümmeln. Dazu muß ich den rechten Ellenbogen mit einem
Stück Plastik auffüttern und dieses dann in die passende Form
feilen. Anschließend wird der Arm wieder angeklebt und der
Übergang egalisiert, durch spachteln oder feilen. Beim linken Arm
geht es einfacher. Da dort der Spalt kleiner ist, kann ich ihn mit
Füllmittel und Sekundenkleber füllen.
Nun sieht er schon eher wie ein Fahrer aus.
Leider
schaffte mir meine Humanität ein Problem, das sich erst bein
Einpassen des Fahrers ins fertige Modell offenbarte. Die Händ
sitzen genau da wo die graue Wanne innen endet! Als echter Humanist
habe ich in die Wanne eine Aussparung geschnitten. Man kann das auch
marzialischer lösen.
Manche
werden nun fragen was mit dem Kopf ist? Die sind ja beide gleich! Ja,
aber nur solange er keinen Helm auf hat. Unter dem Helm verschwindet
alles bis auf das Gesicht. Da sieht man dann nicht mehr viel mehr als das
Kinn.
Hinweis:
Derweil ist der Ontos in 1/16 von Trumpeter herausgekommen. Hier gibt
es wieder nur eine Figur, einen Kommandanten, was auch sonst! Aber der
hat zum Helm auch noch die Brille auf! So gesehen sollte man hier
mal hoffen das diese Figur als Einzelfigur aufgelegt wird oder sich den
Kit kaufen.
Der Helm ist dreiteilig und besteht aus zwei Halbschalen
und dem Mikrofonteil. Die Helmhalbschalen müssen erst mal von
innen lackiert werden, da man sonst nicht mehr dran kommt. Dann
muß der Kopf und der Halsbereich (wenigstens) fertig bemalt sein.
Eigentlich sollte man die ganze Figur fertig lackiert haben bevor man
den Helm montiert, denn der geht nur als Halbschalen über den
dicken Schädel. Will man den Helm abgesetzt darstellen muß
der Kopf noch "frisiert" werden, denn der Fahrer hat eine echte
"Helmfrisur" mit Abstandsecken oben und hinten.
Bei der
Kommandantenfigur bleibt der Kopf wie er geplant ist und die Arme
ebenfalls. Da man die Arme hier gerennt besser lackieren kann,
spieße ich sie auf einen Schaschlikspieß. Nur den Kopf
klebe ich bereits in Position. Für den Helm gilt das gleich wie
beim Fahrer.
Was
ich nach der Lackierung gemacht habe, sollte eigentlich schon vorher
passieren, die Kommandantenfigur muß in der Schießhaltung
in die Kommandantenluke eingepaßt werden. Da die Figur das MG
bedient, gibt dieses die Position vor. Das macht alles etwas
schwieriger, da die Figur zu kurz erscheint. Daher habe ich sie mit
Epoxidkit verlängert, nur um dann festzustellen, daß sie
eigntlich gekürzt werden muß. Das MG zwingt den Kommandanten
zu einer geduckteren, nach hinten gelehnten Haltung. Die Figur
sitzt/steht aber eigentlich aufrecht. Um sie nun in die sehr enge Luke
zu bekommen, muß sie an verschiedenen stellen amputiert werden.
Besonders die ausgebeulten Seitentaschen stören und müssen
abgeflacht werden. Auch das Schanier der Luke ist eigentlich im Weg.
der Kommandant sitzt so weit hinten, das seine Feldjacke über
dieses Scharnier hängt. Das muß durch Aussparen und
anmodellieren ausgeglichen werden. Ich benutze einen Epoxidkit der
speziell zum modellieren auch mit Wasser geglättet wird. Das nutze
ich um die Figur genau einzupassen, indem ich sie naß mache und
dann in Position drücke. So bleibt der Kit nicht an der Luke
hängen und wird in Paßform gepresst. Den Kit nun
Aushärten lassen und dann mit Schleifpapier und Schleifschwamm
glätten. Anschließend wird die Farbgebung angepaßt.
Den
restlichen Unterschied macht die Bemalung. Da die Figur die gleiche
Kleidung trägt, mit exakt den gleichen Faltenwurf, sollte man hier
etwas kreativ sein. Möglicherweise auch die Falten noch mit
der Feile bearbeiten. Da der Fahrer aber ab der Schulter
abwärts im Panzer verschwindet, braucht man sich hier nicht
allzugroße Sorgen machen. Das meiste geht daher mit Farbe. z.B.
kann man dem Kommandanten eine getarnte Schutzweste verpassen und dem
Fahrer nur eine grüne.
Ich
habe beide Fahrer in olivgrünem Drillich bemalt. Da die Uniformen
in dieser Zeitspanne noch einfarbig Oliv waren. Allerdings variierten
die Farbtöne je nach Alter und Anzahl der Waschgänge die sie
hinter sich hatten. So kamen sehr unterschiedliche Abstufungen zustande,
die immer blasser und bläulicher wurden.
Meine beiden Mannen
haben aber schon ein paar Kilometer mit dem Panzer durch Staub und
Dreck hinter sich und bekommen daher diverse Schichten Drybrushing und
ein Darkwash in braun-schwarz überdeckt von einem letzten
sandgelben Drybrushing.
Die Gesichter sind am schwierigsten.
Hier geht man vor wie beim Make up, Grundieren in Fleischfarbe, dann
rote Flecken an den Wangen und anderen besser durchbluteten Stellen.
Hierfür nehme ich ein tranparentes Rot und gehe dann mit einer
gleichartigen Farbe in hellem Fleischton darüber um beides zu
vermischen. Dafür eignen sich gut die Tamiya Farben. Das trocknen
lassen.
Dann ein Darkwash aus Rotbraun. Wieder trocknen lassen.
Nun
mit Weiß und einen 10/0er Pinsel den Augenhintergrund auftragen.
Achtung, nicht zuviel. Vom Weiß in den Augen sieht man eigentlich
nur etwas wenn sie weit aufgerissen werden! Trocknen lassen.
Mit
dem gleichen feinen Pinsel wird dann die Iris als schwarzer Punkt
aufgetragen. Dabei unbedingt darauf achten das die Blickrichtung
stimmt, ansonsten schielt der arme Kerl. Manchmal braucht es mehrere
Versuche, daher Wattestäbchen griffbereit legen.
Über der
Iris wird nun noch der Schatten des oberen Augenliedes angedeutet.
Fertig sind die Augen. Trocken lassen und anschließend ein
dunkleres Wash auf das ganze Gesicht auftragen. Danach mit dem hellen
Hautton die glänzenden Stellen hervorheben. Geht einfach mit der Drybushing Technik. Fertig.
Zur Montage am Fahrzeug gibt es
verschiedenen Möglichkeiten. Für den Fahrer kann man für
permanente Befestigung auf doppelseitiges Montageband, das mit der
Schaumstoffüllung, zurückgreifen. Wer den Fahrer gerne mal
wegläßt, sollte Magneten in die Figur kleben und eine
Eisenplatte in die Sitzfläche.
Der Kommandant ist etwas
komplizierter, da er sowohl am MG "hängt" als auch in der Luke
"steckt".
Ich
habe mich zu der improvisierten Lösung auf den Bildern oben
entschieden. Nachteil man kann die Figur nicht ganz so einfach
entfernen.
Aus
einer schwarzen PS-Platte, mit 2mm Stärke, habe ich eine
Kreissektion von 40mm Durchmesser geschnitten. Die Position der Figur
angezeichnet und die Platte soweit eingekürzt, daß sie nur
noch unter den Beinen der Figur sitzt. Dabei muß beachtet werden,
daß die Einschübe der Winkelspiegel nich verdeckt werden!
Von unten dann eine 2mm Bohrung durch Platte und Figur und eine passende Schraube rein, fertig!
Abschließend
bekommen die Figuren noch die Rangabzeichen und Einheitsembleme. Nur
weil der neue M4A3 Sherman mit Figur kommt und diese auch einzeln zu
bekommen ist, gelang es mir ungefähr die richtigen Abziehbilder
für die Figuren zu finden. Meine Heimatstadt war Jahrzehnte lang
ein US ARMY Lager mit städtischem Anhang, scherzhaft "Die
größte Panzerwerkstatt Europas" genannt, weil man nur Panzer
stehen sah an denen irgend was repariert wurde.
Ich wollte dieses
Fahrzeug, von dem ich nicht weiß ob es hier jemals stationiert
war, es aber glaube gesehen zu haben als kleiner Junge, in den Farben
der MASSTER Tarnung der 1970er, mit den Abzeichen der "Iron Brigade"
genauer der "3rd Armored Division" wiedergeben und dazu gehören
natürlich auch die Schulteraufnäher. Ich besitze noch einen
nagelneuen Satz der Grünen im Feld genutzten Aufnäher. Als
Abziehbilder gibt es die aber noch nirgends. Daher der Griff zu den aus
dem Figurenbausatz. Die Nummer im gelben Bereich passt hier zwar auch
nicht, aber die Uniform ist ja verschmutzt und daher kann man es da
nicht lesen.
Um die Abziehbilder aufzutragen gibt es unterschiedliche
Methoden, die ich über die Jahre praktiziert habe. Eine ist das
Wasser schön heiß zu machen und den Aufkleber dann mit einen
feuchten Wattestäbchen in die Falten der Uniform zu drücken.
Das Wasser zu entfernen und mit der Airbrush einen Hauch
Nitroverdünner darüber zu sprühen. Der Hauch muß
sehr vorsichtig dosiert sein, denn er soll den Aufkleber nur weich
machen, nicht auflösen! Bei so kleinen Aufklebern ist das wirklich
schwierig und daher habe ich diesmal mit dem Decal-Weichmacher von
Humbrol gearbeitet. Vorher wurden die Stellen an den Armen der
Figur aber schon mit Acrylklarlack lackiert. Dann kam der Weichmache
drauf, dann das Abziehbild und noch eine dünne Schicht
Weichmacher. Alles wurde über nacht trocknen gelassen und dann mit
halbmattem Klarlack überlackiert, um es der restlichen Figur
anzugleichen. Nach dem Trocknen noch ein Drybrushing mit dem gleichen
Ton mit dem die Uniform vorher schon behandelt wurde und fertig ist die
Figur.
Die
Winkelspiegel
Die
Winkelspiegel werden aus einem Streifen klarem Plastik mit 2mm Dicke
hergestellt. 2mm weil die genau in den Spalt passen. Die Breite der
Spiegel variiert zwischen 8 mm und 10 mm und muß eingepasst werden.
Am oberen Ende wird der Spiegel im 45° Winkel angeschliffen. Dann
poliert und anschließend mit Silber lackiert, nur die
Spiegelfläche! Der Rest wird schwarz gestrichen, auch die
Spiegelfläche, nach dem das Silber getrocknet ist. Ich habe auf
der Rückseite je einen PS-Streifen aufgeklebt, der die genaue
Einschubtiefe begrenzt. Nur auf der Rückseite sollte man das
machen, da ansonsten die Spiegel nicht mehr eingesetzt werden
können! Da es im Turm dunkel ist, muß man das Sichtfenster
unten nicht anschrägen und eigentlich auch nicht freilassen. Die
Spiegel sind nach dem Einsetzten sowieso dunkel. Sie werden in die
jeweiligen Einschübe gesteckt und halten, bei paßgenauer
Herstellung von alleine. Ich habe sie aber trotzdem mit einen Tropfen
Sekundenkleber von unten gesichert.
Der
Winkelspiegel der Zieloptik wird genauso hergestellt, bis auch die
Ausnahme das er von beiden Seiten PS-Streifen bekommt. Der Einschub im
Turm ist etwas dicker als die anderen, daher zusätzliche Streifen.
Um ein festkleben kommt man hier auch kaum herum, ansonsten besteht die
Gefahr, daß der Spiegel im Betrieb herausfällt.
| Fahrzeugelektrik/Beleuchtung
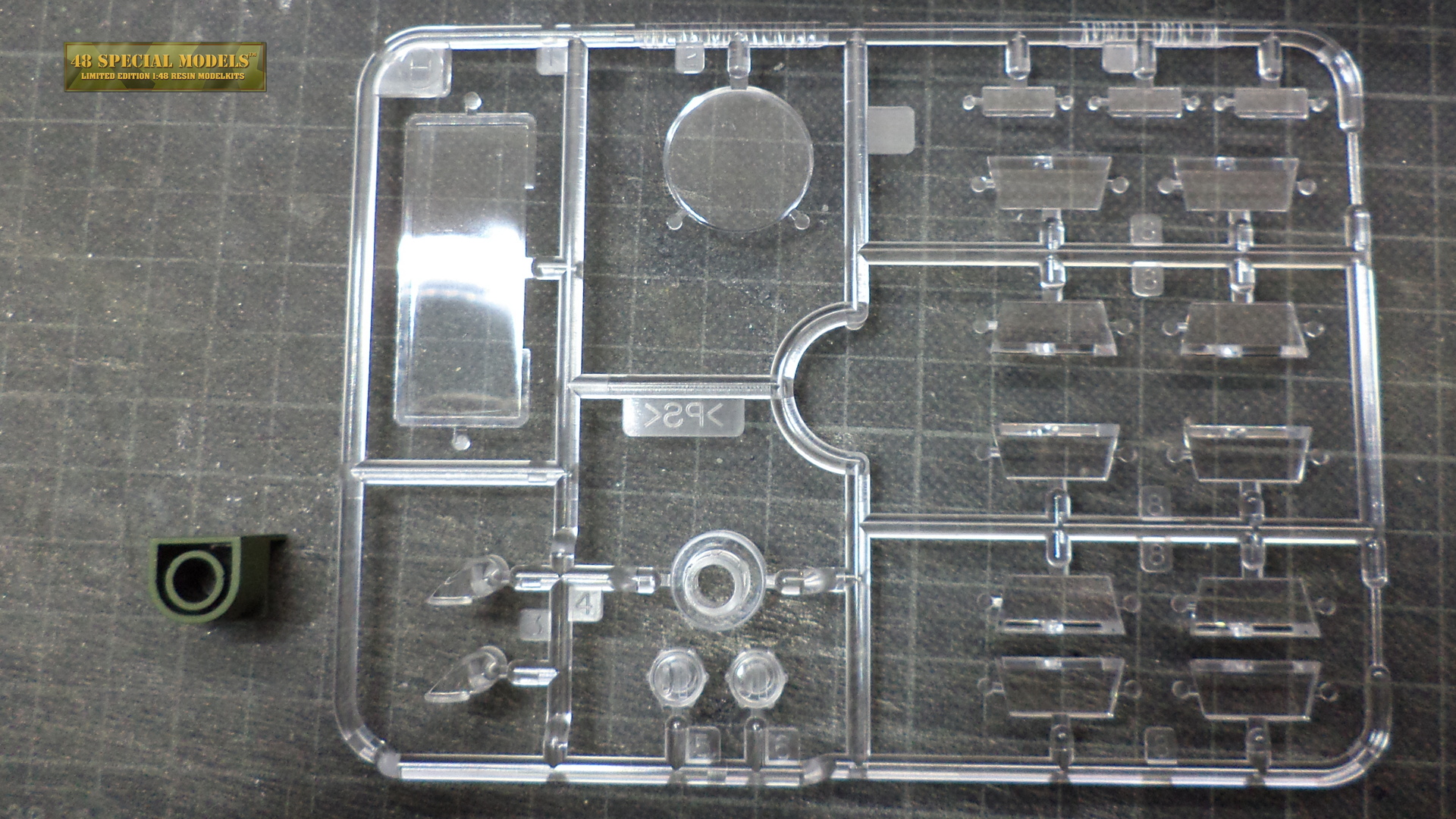 | 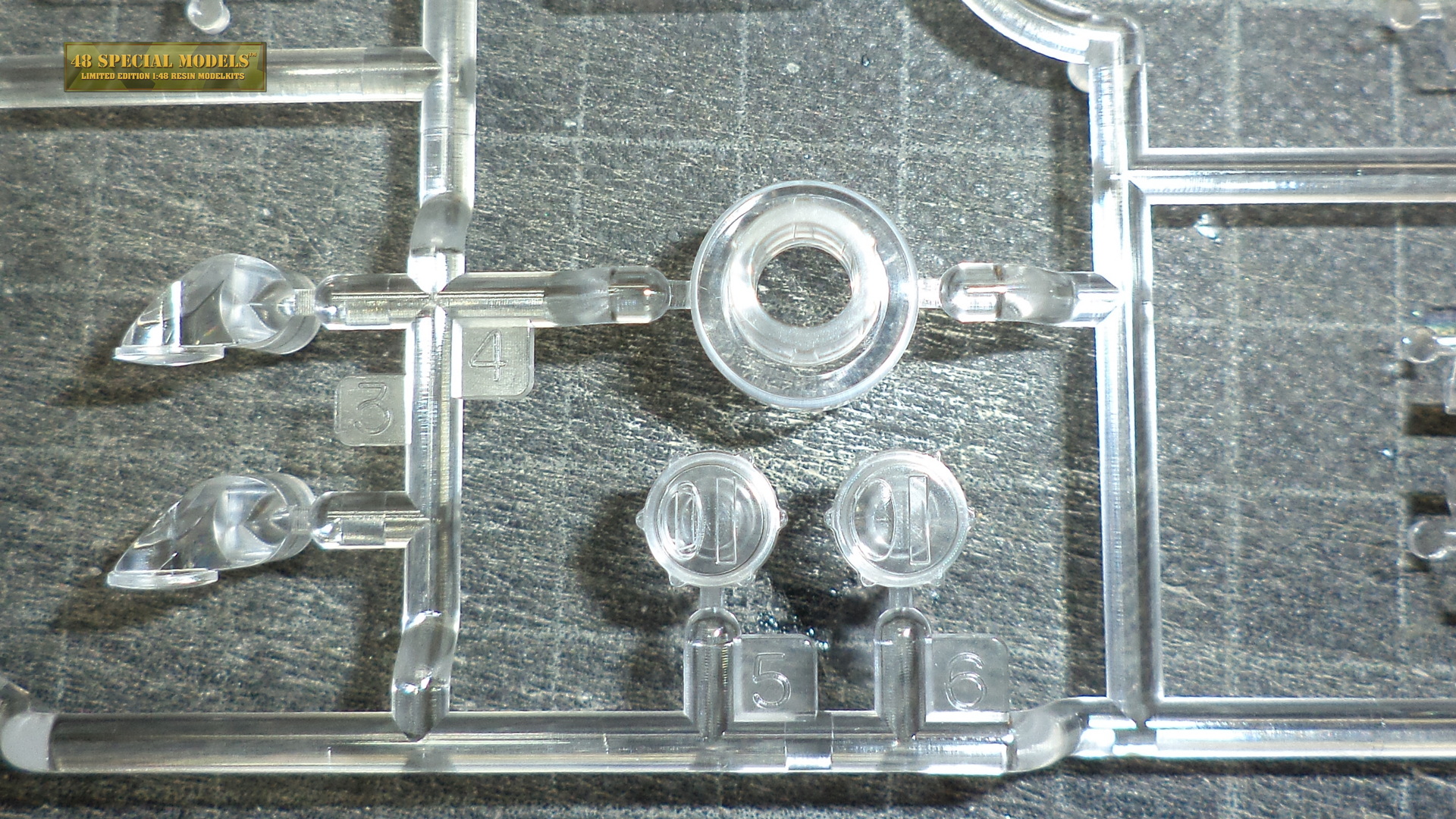 | | Vergleich der Rücklichter. Links das gedruckte Teil, rechts der Spritzling von Tamiya. | Wir brauchen davon nur die beiden kleinen runden Teile Nr. 5 und 6. |  |  | | Um
das fast unmögliche einkleben von Glasteilen in die
Rücklichtaufnahme zu umgehen hat Tamiya die Teile einfach klar
gespritzt und in eine Stück. | Die
Teile werden erst von außen silber und dann Olivgrün
lackiert, dabei werden die Bereiche wo Licht durchscheinen soll
abgeklebt.
Von hinten wird dann schließlich einfach eine weiße 5mm LED eingesetzt. |  | 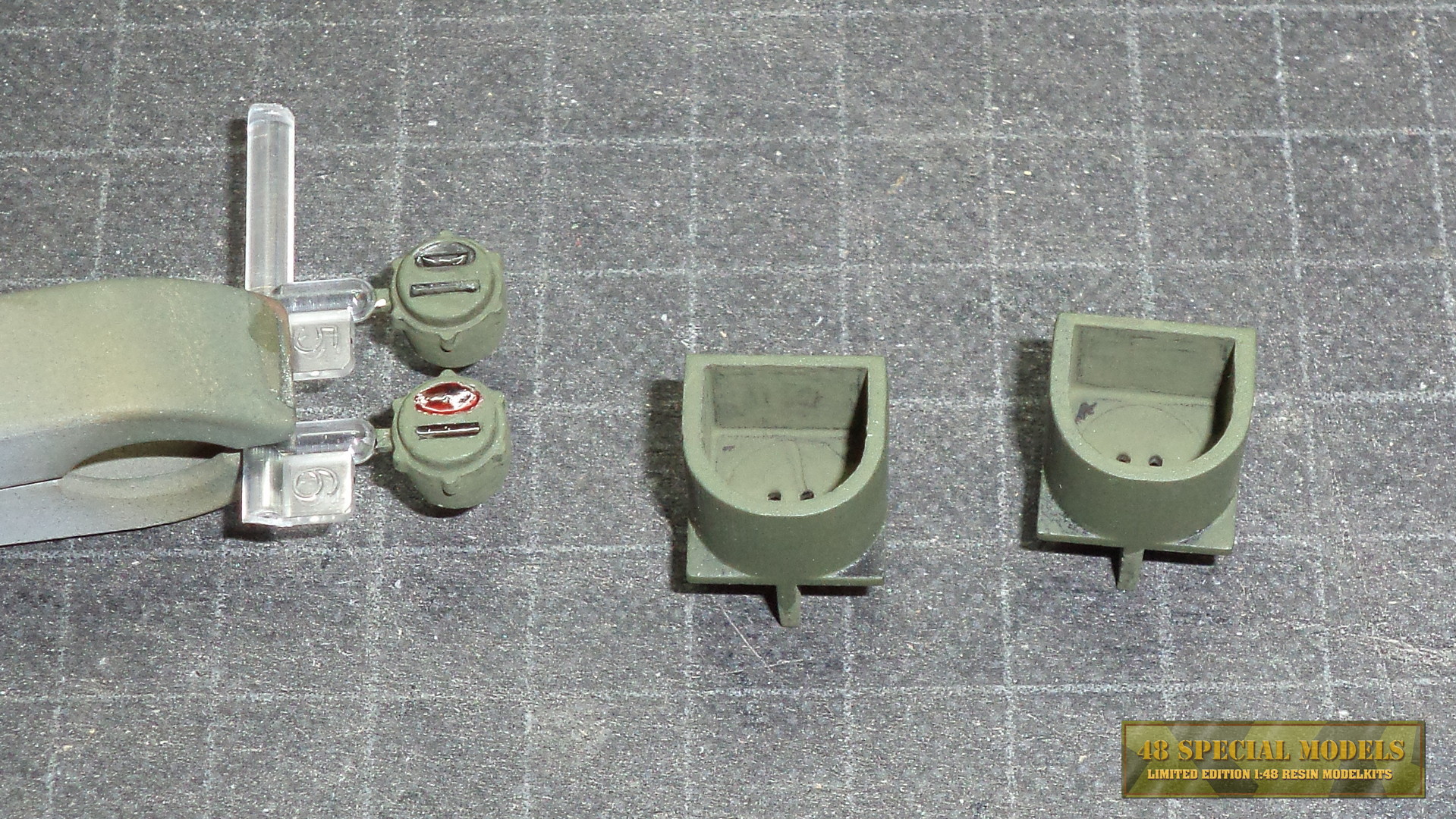
| Zwischenstufe der Bemalung von außen: zuerst Silber dann Grün.
Mit einen Zahnstocher können die leicht übermalten Stellen wieder gereinigt werden. | Die Aufnahmen für die Rücklichter wurden ausgefräst und lackiert.
In
die kleinen Löcher werden die LEDs eingeführt und von hinten
angelötet. Die Rücklichter werden dann auf die LED gesteckt
und halten eigentlich ohne kleben. | 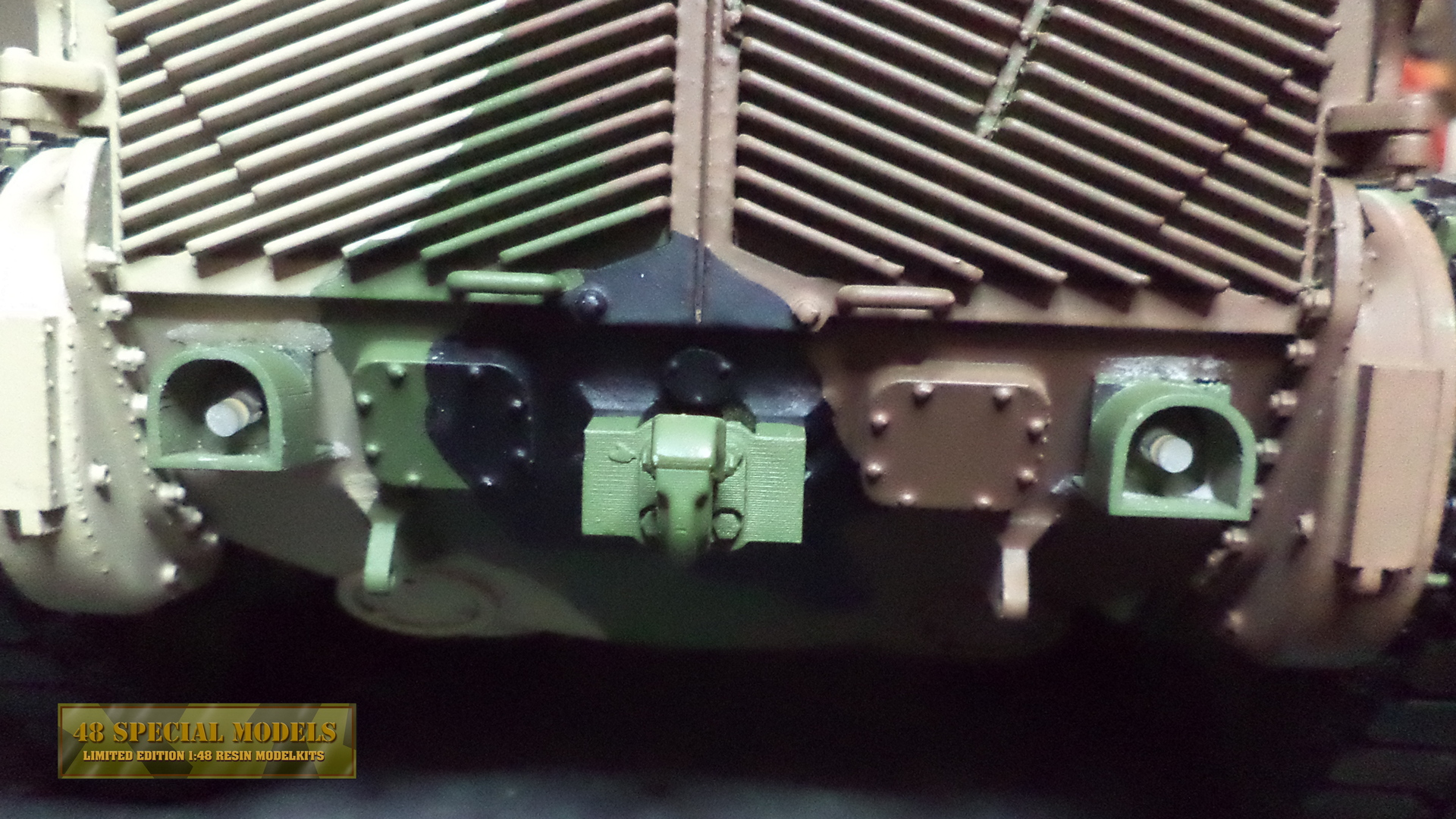 | 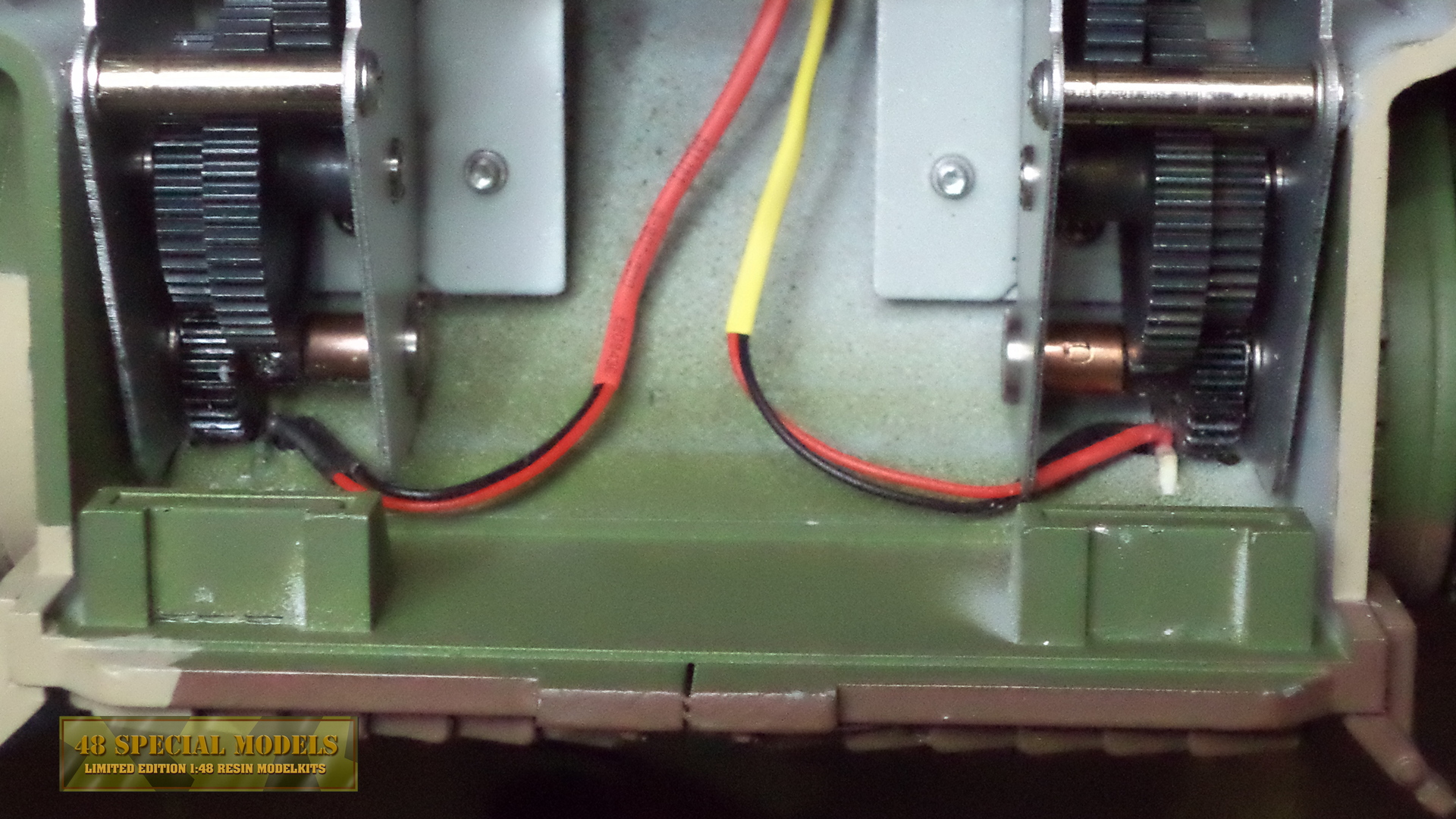 | Die
Kabel werden durch die Rückwand geführt. Dazu müssen die
vorbereiteten Löcher etwas aufgeweitet und angepasst werden.
| Denn
die vorbereiteten Löcher liegen genau hinter dem Zahnrad der
Getriebeeinheit. Der denkbar schlechteste Platz sie durchzuführen. | 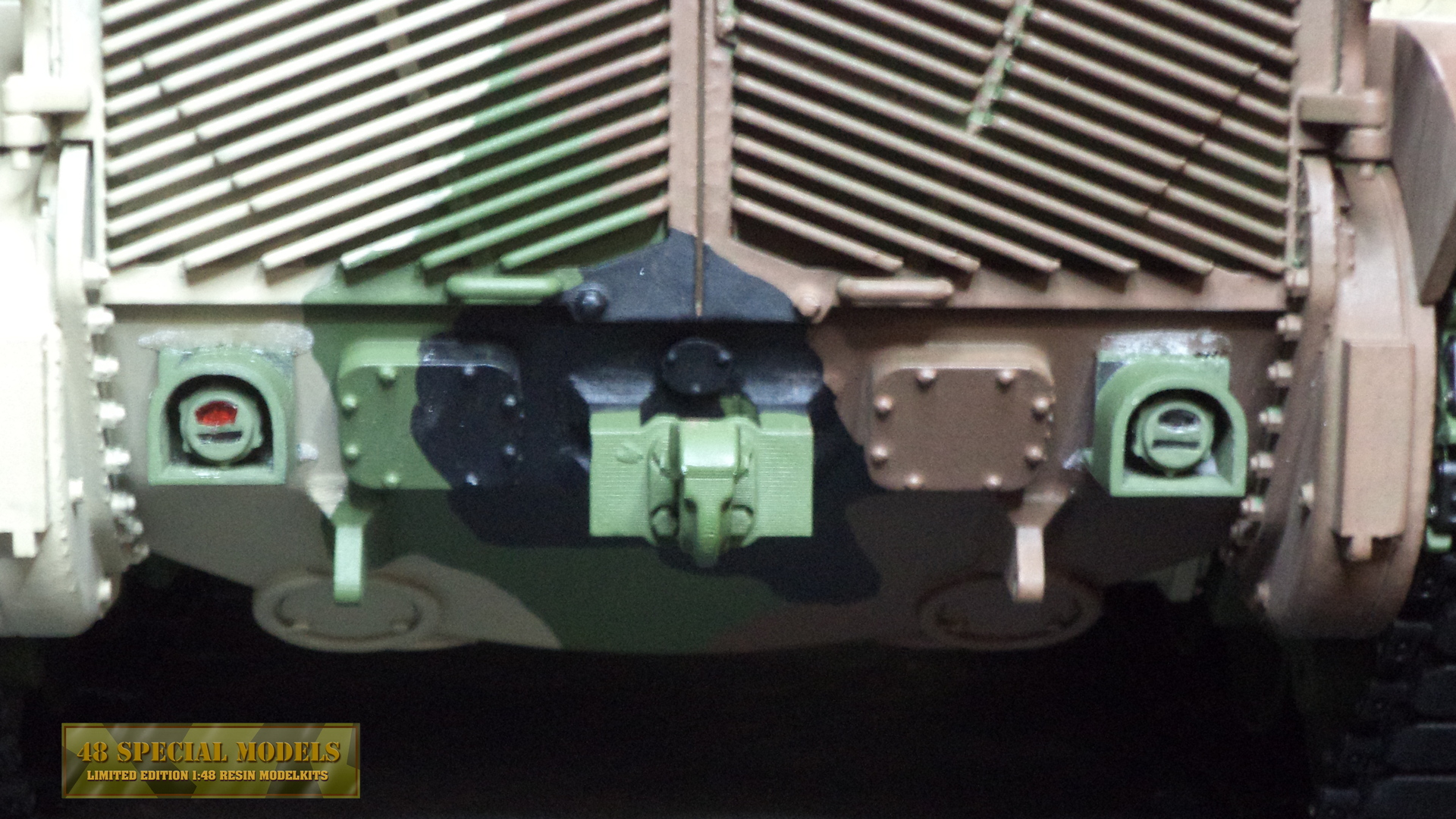 | | Auf die LEDs werden die Rücklichter nur aufgeschoben und hinten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert.
|
| 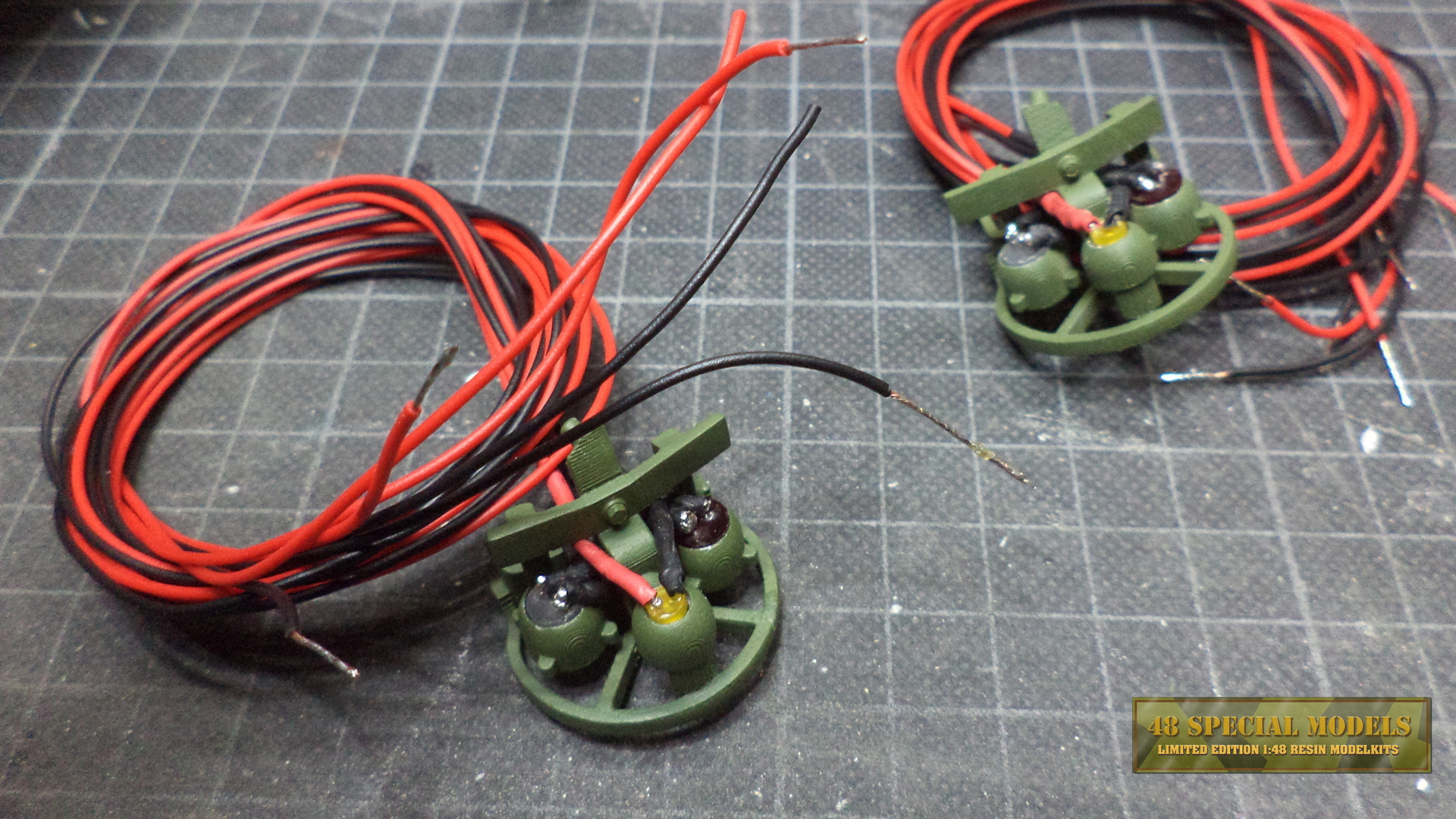 | 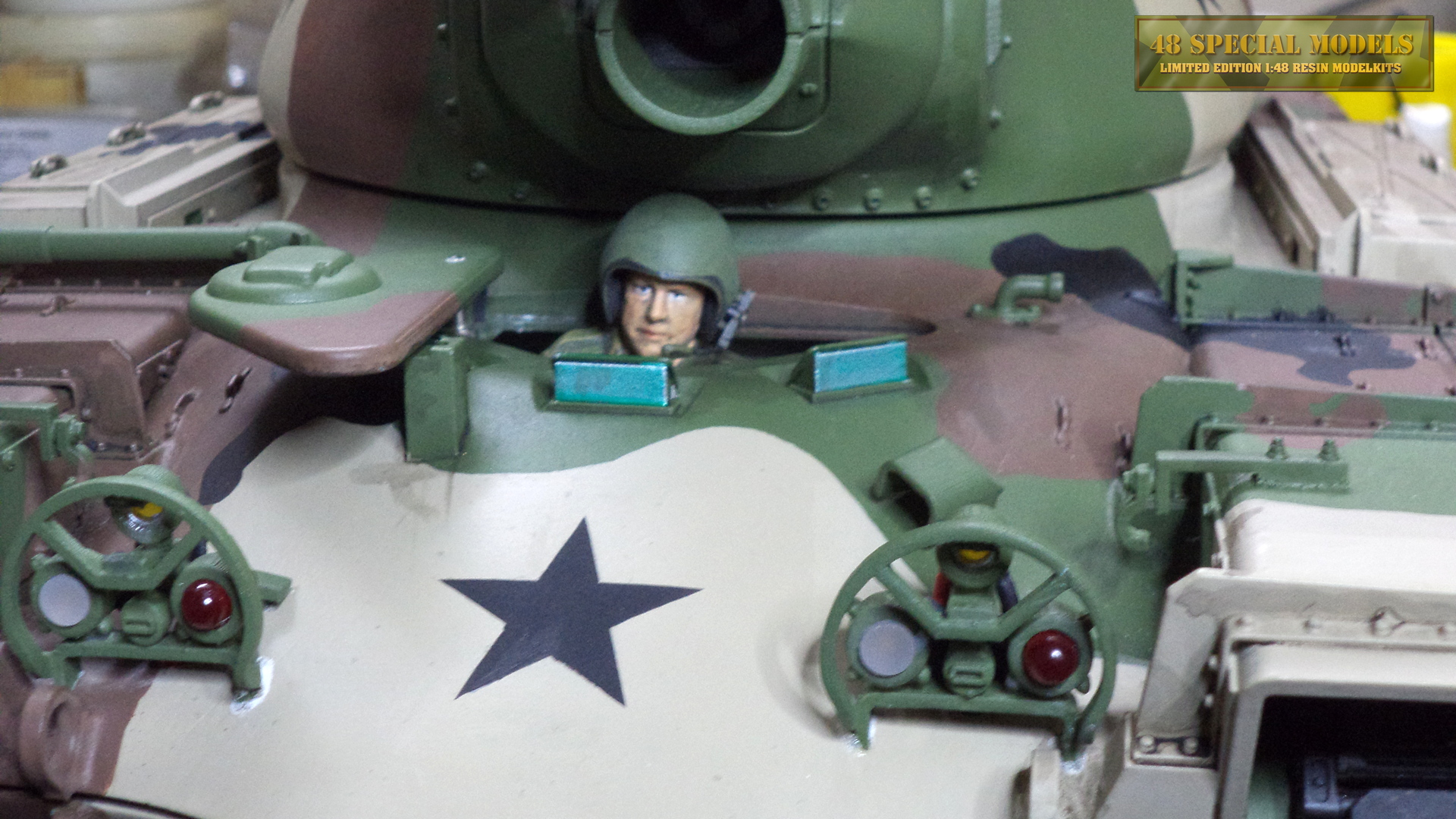 | | Da
jede LED der Frontbeleuchtung einzeln angesteuert werden soll, benötigt man für
alle eine eigene Verdrahtung. Da ich keine kleineren Litzen hatte, wird es wohl eng in der Kabeldurchführung. | Die fertig eingebaute Frontbeleuchtung. |
| Die
gedruckten Rücklichter haben mir nicht wirklich gefallen.
Allerdings verhält es sich bei diesen wie bei der Figur, es gibt
nur einen Bausatz in dem authentische US ARMY Fahrzeugrückleuchten aus der Zeit nach 1945 enthalten sind.
Ich
habe mal einen Satz originale Rücklichter auf einem Flohmarkt gekauft, daher
weiß ich wie diese Teile wirklich aussehen. Die meisten
Modellbauer sind ihnen aber sicher nie näher als bis zu einem Foto
gekommen.
Daher ist es nicht einfach dieses Detail richtig zu Gestalten.
Die Rücklichter bestehen aus zwei unterschiedlichen
Leuchten. Neben der ovalen roten Rückleuchte und der Bremsleuchte
für den Normalbetrieb enthalten sie auch Tarnlicht. Das ist der
rechteckige Bereich. Das Tarnlicht ist weiß und abgemildert.
In
der Tamiya Bauanleitung wird der ovale Bereich transparent Rot und der
rechteckige Bereich Smoke lackiert. Die restliche Fassung wird von
außen erst mit Silber und nach dem Trocknen dann mit
Olivgrün lackiert. Das Silber dient als Reflektor und macht die
Leuchte ansonsten Lichtundurchlässig. Das Grün ist der
äußere Tarnanstrich.
In die Leuchten wird dann von hinten eine weiß difus leuchtende LED eingesetzt.
Um
die Rücklichter am Fahrzeug zu befestigen, benötige ich noch
die gedruckte Halterung, allerdings ohne den ringförmigen
Innenbereich. Der wird entfernt, indem ich ihn mit dem Fräser
herausfräse. Dann kann die Rückleuchte eingepaßt und
befestigt werden. In der Halterung sind zwei kleine Löcher für
die Kabeldurchführung. Man kann hier auch nur die LED Pins
durchstecken und dann so verbiegen, das die LED fest sitzt.
Anschließend lötet man das Kabel an und schiebt die
Rückleuchte auf die LED. Zu beachten ist dabei, daß an den
Leuchten eine Nase angegossen ist, die am M551 in eine Nut eingesetzt
wird, welche hier nicht vorhanden ist. Daher muß man die Nase
abschleifen. Außerdem gibt es eine rechte und eine linke
Rückleuchte, die man nicht verwechseln sollte. Man kann die LED
auch zusätzlich festkleben, falls sie durch biegen der Kontakte
nicht fest genug sitzt, daß erschwert aber das auswechseln.
Vor der endgültigen Montage sollte auf jeden Fall ein Funktionstest erfolgen!
Bevor
die Rückleuten am Panzer montiert werden, muß erst der
Kabelverlauf geklärt werden. Die Getriebe sitzen leider beide
gefährlich nahe an der Durchlaßbohrung für die Kabel.
Daher muß zuerst geklärt werden, wie das Kabel sicher im
Fahrzeug verlegt wird und ob die Kontakte an der LED nicht am
Getriebegehäuse kurzgeschlossen werden. Das ist etwas kniffelig
und macht auch einige Stücke Schrumpfschlauch
nötig. Da mir derzeit noch die passenden LEDs fehlen kommt die
Erfolgsmeldung später.
O.K.
die LEDs sind mittlerweile da. Ich konnte sogar zylinderförmige
warmweiße 3 mm LEDs bekommen. Der Einbau hat sich problematisch
gestaltet, da die Kontaktdrähte beim durchführen durch die
Bordwand genau auf dem Getriebe enden und dort blank anliegen. Daher
mußte ich die beiden kleinen Löcher in der Lampenhalterung
aufweiten und auch den Durchbruch durch die Rückwand erweitern,
damit ich ein Kabel mit Schrumpfschlauch
darüber hindurchführen konnte (siehe Bild oben). Dabei
habe ich die Bohrung weiter zur Mitte verlagert, um vom Getriebe
Abstand zu bekommen. Die Kontaktdrähte wurden dann zur Mitte
umgebogen. Von außen wurde die Lampenhalterung mit
dickflüssigem Sekundenkleber befestigt, nachdem sie mit
schnellhaftendem SK fixiert war. Abstreuen der Klebenaht erzeugte auch
hier eine Schweißnaht.
Dann kam die LED mit bereits
angelötetem Kabel hinein. Das Kabel wurde durchgezogen und so kurz
wie möglich an der Innenseite umgebogen. Umbiegen sollte man die
Kontaktdrähte übrigens nur einmal, da sie sonst leicht
abbrechen! Leider wackelten die LEDs danach auch noch, so daß ich
sie auch ankleben mußte. Das Leuchtengehäuse wurde dann
aufgesteckt und hält eigentlich ohne Kleber, da die Teile aber
selten sind und ich sie im Gelände nicht verlieren möchte,
wurden auch sie mit SK fixiert.
Das Kabel wurde dann vorläufig
unter denEinbauteilen hindurch verlegt und in Abständen mit
Schrumpfschlauch zusammengehalten. Da mir die Elektronik noch nicht
vorliegt bleiben die Kabel vorerst länger als vermutlich
nötig und werden sicher verstaut.
Die Frontbeleuchtung
Der
Einbau der LEDs in der Frontbeleuchtung sieht einfach aus, hat aber
seine Tücken. Zum einen sind die gedruckten Beleuchtungshalter
relativ empfindlich und brechen leicht, zum anderen stören die
langen Kontakte der LED beim Einsetzen in die Fassungen. Ich hatte
zuerst die LEDs mit Kabeln verlötet und dann die
Kontaktdrähte gekürzt. Das nur damit die LED beim löten
nicht überhitzt. Leider sind die Kabellötstellen dennoch zu
lang und so muß ich nochmal neu anfangen.
Die Standard 5 mm
Dioden lassen sich schon so kaum in die Fassung einsetzen, sobald man
aber die Kontakte abwinkelt geht gar nichts mehr, da es unmöglich
ist die Kabel so zu verlegen wie zwingend nötig. Daher muß
das Kabelende so dicht wie möglich an die Diode gelötet
werden. Dazu wird die Litze einfach um den Kontaktdraht der LED dicht
am Gehäuse gewickelt und verdrillt, so daß sie zur
Seite weggeht. Den Kontaktdraht läßt man so lang wie
möglich, um ein schnelles Abkühlen zu ermöglichen. Dann
die Stelle zügig anlöten und schnell abkühlen. Kurz die
Diode testen ob sie keinen Schaden genommen hat und dann die
Kontaktedrähte so kurz wie möglich abtrennen. Schrumpfschlauch drüber und nun kann die
Diode in die Halterung eingesetzt werden.
Notwendige Vorwiderstände sollten an der Platine angelötet werden, sofern sie nicht schon vorhanden sind.
Die
Löcher für die Kabeldurchführung in der Oberwanne
mußte ich etwas aufweiten, da ich relativ dicke Kabel verwendet
habe und jede Diode 2 davon hat, um sie alle getrennt ansteuern zu
können. Hat man den Kabelstrang erst mal durch die Oberwanne
bekommen ergibt sich der Rest von alleine. Die Halter passen in die
Kerben auf der Oberseite und werden dort festgeklebt. Schöner
wäre es aber man könnte sie durch Schlitze in der Oberwanne
einsetzten und von unten verschrauben. Das erleichtert das Auswechseln
im Schadefall erheblich.
Wenn
die Beleuchtung eingebaut ist und funktioniert kann man die Rückseite der LED noch schwarz und anschließend in
Fahrzeugfarbe lackieren um ein durchscheinen nach hinten zu verhindern.
| Die Fahrerluke
Die
Luke des Fahrers schwingt nach rechts auf wenn dieser sie öffnet.
Sie wird dann auf zwei Auflagepunkten abgesetzt und arretiert sich durch
ihr eigenes Gewicht, sobald sie abgesenkt wird. Soweit die Theorie.
Wie
sich herausstellte ist die zweite Ablagestütze, die sich vor der
Abgasleitung befindet, zu weit entfernt um mit der Luke in Kontakt zu
treten.
Es
war sehr schwierig herauszufinden wie der
Mechanismus der Luke genau aussieht und funktioniert, da niemand
davon Bilder ins Netz gestellt/aufgenommen hat. Einziger Vorteil ist,
daß das System auch beim M60 so funktioniert und von dem gibt es
mehr
Bilder.
Eigentlich ist das solange kein Problem, wie man
die Luke geschlossen läßt. Hat man aber, wie ich den Fahrer
schon fertig und will ihn dort wie Killroy herausschauen lassen, bedarf
es einer technischen Lösung für die offene Luke.
Das
Bauteil kommt separat mit angedrucktem Hebezylinder und auch in der
Oberwanne ist das öffnen der Luke schon vorbereitet mit einer
Bohrung für den Heber. Was fehlt sind alle anderen Teile für
einen funktionstüchtigen Mechanismus.
Ich hatte zudem den
Ehrgeiz die Luke eventuell wieder schließen zu können, z.B.
wenn der Fahrer mal Urlaub hat oder austreten ist. Also bedurfte es
eines funktionstüchtigen Öffnungs- und
Schließmechanismus. Eigentlich ganz einfach dachte ich. Bohre
eine Loch in den Zylinder, nimm zwei U-Scheiben und eine weiche
Druckfeder, welche über den Zylinder paßt und montiere es.
Dazu die Luke mit dem Zylinder durch das Loch in der Oberwanne
schieben, eine passende U-Scheibe darüber legen, dann die Feder
und eine weitere U-Scheibedarüber. Alles mit einer
Breitkopfschraube die in das Loch im Zylinder paßt festschrauben.
Zieht man nun die Luke hoch hat sie Spannung nach unten. Man dreht sie
nach rechts und legt sie auf den Lagerpunkten ab, fertig. Von wegen.
Der
zweite Lagerpunkt ist zu weit weg und selbst wenn er nahe genug
wäre, würde die Feder den Teil am Zylinder wieder in das Loch
drücken. Den zweiten Lagerpunkt jetzt noch umsetzten war mir
zuviel Arbeit. Wäre ich am Anfang bei der Unlakierten Oberwanne
auf das Problem gestoßen hätte ich es da geändert, aber
beim fertig lackierten Modell mußte es anders gelöst werden.
Es
gibt auch eine Lösung und die ist recht einfach. Sie besteht aus
einer ø2mm Schraube die in ein Loch im Lukendeckel geschraubt
wird. Dieses Loch liegt in gerader Linie hinter dem Zylinder, wenn man
eine gedachte Linie vom vorderen Auflagepunkt zum Zylinder zieht und
diese darüber hinaus verlängert. Der Abstand vom Zylinder
sollte 2-3mm sein und man muß das Loch bei geschlossener Luke von
unten durch die Oberwanne bohren mit einem ø1,6 mm Bohrer. Vorsicht nicht durch die Luke bohren, sonst muß man die Oberseite verspachteln und lackieren.
Das Loch in der Oberwanne wird dann auf ca. ø2,3mm aufgeweitet. Die ø2mm Schraube vorsichtig in den Lukendeckel schrauben und den Kopf abtrennen. Anschließend den Lukendeckel
anhalten und die exakte Höhe markieren, Die Schraube dazu passend
mit dem Minitrennschleifer abtrennen und schwarz anmalen. Nun die
DRuckfeder und die unter U-Scheibe wieder montieren und mit der anderen
Schraube sichern. Die ober U-Scheibe fällt hier weg, da sie
stört.
Jetzt kann der Lukendeckel
angehoben und nach rechtsgeschwenkt werden. Dann auf der vorderen
Ablage abgelegt werden, während die Schraube ihn am anderen Ende
daran hindert von der Feder zurück ins Loch gedrückt zu
werden. Dabei braucht die Feder nur sehr geringen Druck auszuüben.
Ich habe eine Sammlung mit allen möglichen Federn, die ich
bei verschiedenen Gelegenheiten, aus unterschiedlichsten Geräten,
ausgebaut habe, anstatt diese einfach weg zu werfen. Auf diese weise
sammelte sich eine stattliche Anzahl unterschiedlichster Spiralfedern
an, auf die ich in solchen Fällen gerne zurückgreife. Denn
wenn man eine Feder braucht, bekommt man sie garantiert nirgends gerade
passend.
| Das MG M2
 |  | | Aller MG Teile werden Grundiert und auschließend gedrybrusht. | Der Kamerad hat seine MG gefpflegt und keine Rostspuren darauf.
Das geht natürlich auch anders. |
Das
beiligende M2 MG ist eine Kopie des im M551 Kit enthaltenen. Es wurde
lediglich im 3D-Drucker gedruckt. Dennoch muß es an einigen
Stellen nachgearbeitet werden und man sollte alle Löcher
nachbohren, bevor man es zusammenbaut.
Der Lauf besteht aus
einer Edelstahl Kanüle, welche perfekt in den MG Körper
paßt. Man kann ihn festkleben, muß aber nicht. Lauf und MG
Körper sind innen hohl um eine LED und einen Lichtleiter einbauen
zu können.
Alle Teile sollten darüber hinaus schon
fertig lackiert sein. Die Farbgebung ist hinlänglich bekannt unter
Panzerbauern und bedarf kaum einer weiteren Erläuterung.
Das
MG wird in die Laffettierung samt Munitionskiste eingesetzt und mit den
beiliegenden Subminiaturschrauben angeschraubt. Nur die Drehachse vorne, die bis in
die Mun-Box reicht wird mit einer passend gekürzten Stecknadel
verbunden.
In die Laffette, die später in der Ringaufnahme
am Kommandantenluk eingesetzt werden soll, sollte man von unten ein
passendes Loch bohren, in das später eine Schraube mit U-Scheiben
oder entsprechendem Breitkopf eingeschraubt werden kann, damit das MG
im Gelände nicht verloren geht.
| Turmmontage
Bevor
der Turm endgültig auf die Wanne montiert wird, bedarf es einiger
Arbeiten die man von außen nicht sieht. Zuerst muß die
Hebemechanik samt Servos eingebaut werden. Bei meinem Modell waren die
Teile alle schon vormontiert und mußten nur zeitweise ausgebaut
werden. Daher ist das relativ einfach. Das Gschützrohr ist recht
lang und daher hinderlich bei der Arbeit am Turm. Es wird erst ganz zum
Schluß richtig befestigt.
Im
Geschützrohr befindet sich eine GFK-Rohr, das ein Verziehen des
Rohrs verhindert. Da das Geschützrohr aus einem Termoplastischen
Kunststoff gedruckt ist, neigt es dazu sich mit der Zeit der
Schwerkraft zu beugen. Das GFK-Rohr ist nur eingesetzt, nicht
verklebt. Das erleichtert den späteren Einbau der
Blitzlichtdiode für das Battle System.
Außerdem muß die Rohrblende zur Montage des Scheinwerfers möglicherweise nochmal entfernt werden.
Die Kommandantenkuppel ist drehbar
und muß auch eingebaut werden. Dazu zuerst die
Zugangsöffnung auf der Turmunterseite öffnen. So
erlangt man Zugang zum Inneren im hinteren Turmteil. Die Kuppel wird
eingesetzt und von unten der Zahradkranz dagegen geschraubt. Da sie
noch mal ausgebaut werden muß wird diese Montage nur provisorisch
vorgenommen. Zum Einbau der Winkelspiegel und der "Sitzfläche"
für die Figur muß alles nämlich noch mal demontiert werden.
Im Turm sind eine ganze Anzahl
Balastgewichte verbaut. Insgesamt ca. 250g Metallgewichte werden
von innen, mit doppelseitigem Klebeband, gleichmäßig verteilt
auf beide Seiten, an die vordere Turmwandung geklebt. Das soll für
eine gleichmäßige Belastung des Drehkranzes sorgen, da der
Turm nach hinten einseitig Übergewicht hat.
Bei meinem
Modell waren die Gewichte zwar herstellerseitig schon eingeklebt,
hielten aber nicht richtig, so daß ich sie ausbauen mußte.
Die
Klebebandreste klebten dafür permanent an den Metallgewichten und
ließen sich nur durch längeres Einlegen in Aceton
rückstandslos entfernen. Anschließend wurde das Klebeband
wieder neu angebracht (siehe Bild).
Positioniert werden die
Gewichte wie im Bild unten. Dabei kommt es darauf an sie so zu
plazieren, daß sie gut an der Turmwand anliegen. Das sollte man
"trocken" testen, denn einmal angeklebt gehen sie kaum wieder ab. Die
Position ist, wie hier im Bild, vor dem Verschluß rechts und
links an der Turmseite. Dabei ist darauf zu achten, daß einerseits die
Hebemechanik, andererseits der, hier ausgebaute, Lagerring nicht in
ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden!
|
 | 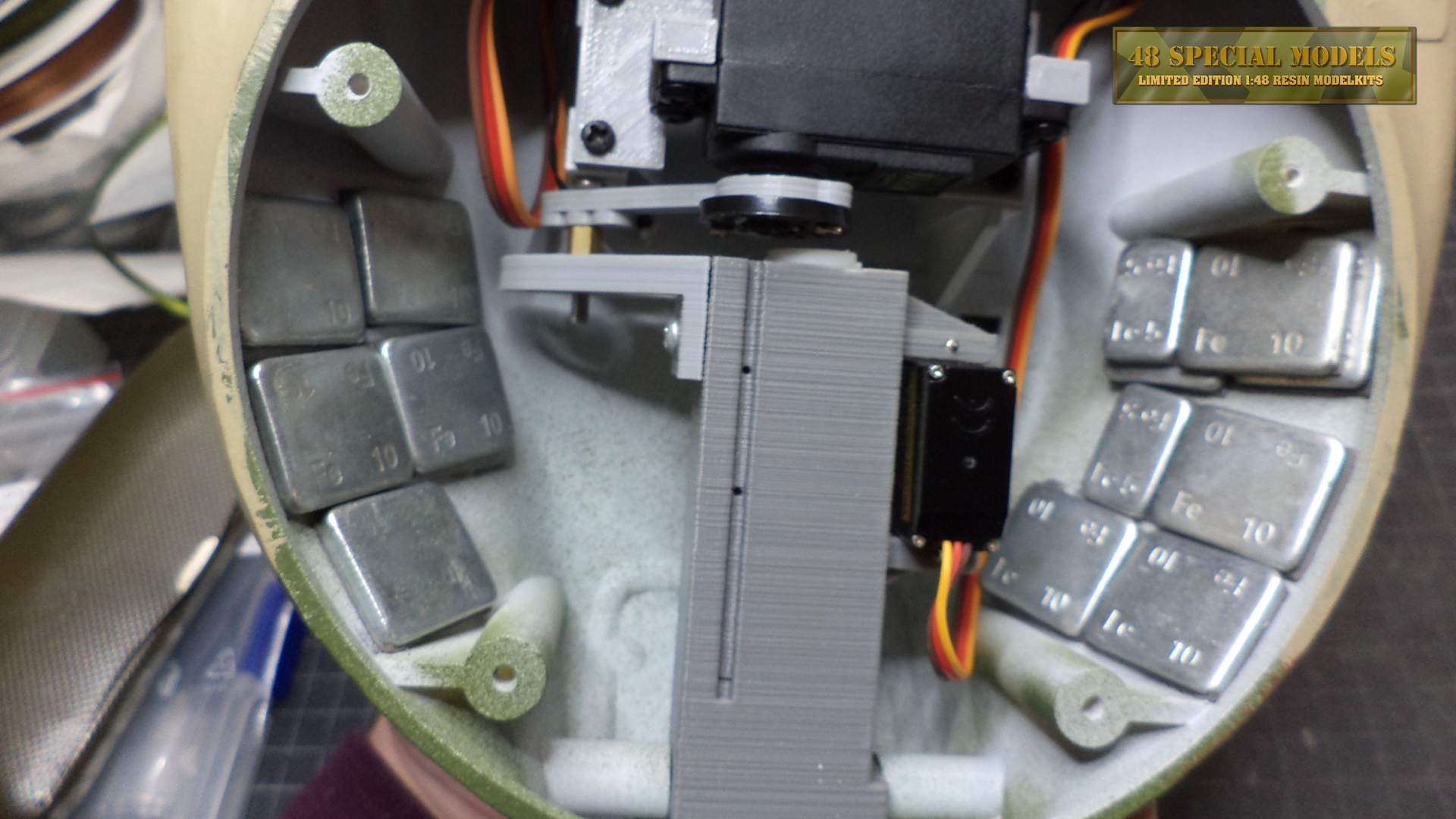 | Die
fettfreien Gewichte werden einfach auf das Klebeband gelegt und
angedrückt.
Anschließend kann man sie einzeln mit dem Cutter
abtrennen. | Da
die Turminnenseite gewölbt ist, sollte man die Plazierung der
Gewichte erst "trocken" testen, damit sie optimal anliegen.
Ist der Klebestreifen erst mal an der Wand geht er nur mit Gewalt wieder ab! |
| Detaillierung
An
der Turmaußenseite sind einige Details verbaut, welche erst nach
dessen Fertigstellung montiert werden sollten oder können. Dazu
gehören die Halter mit den Ersatzkanistern und die Antennensockel.
Die Kanister entstammen dem bereits weiter oben beschriebenen
Classy Hobby Bausatz, da die mitgelieferten nicht korrekt waren.
Dafür kann man aber den gedruckten Kanisterhalter durchaus nutzen,
besonders da er mit zwei relativ dicken Zapfen in Löcher in der
Turmwand eingeklebt wird.
Im Kit enthalten ist auch ein
Rödelriemen mit Verschluß. Leider ist der schwarz und daher
habe ich ihn durch einen Olivgrünen ersetzt. Die Riemen sind 3mm
breite Polyamidbändchen aus dem Geschenke-/Dekobedarf. Man kann
sie auch mit normaler Modellbaufarbe einfärben, was ich hier auch
gemacht habe. Allerdings sollte man sie vorher verkleben (mit
Sekundenkleber).
Wichtig ist die Bänder etwas länger als
nötig zu lassen. Das erleichtert das schließen des Gurtes
erheblich. Auch sollte man die Enden mit etwas Sekundenkleber verkleben,
um sie steif und zuschneidbar zu machen. Die Originalgurte haben
Metallenden die eingequetscht werden, da sonst der Gurt ausfransen
würde. Hier kann das mit etwas Klebstoff verhindert werden und
anschließend kann mit einer feinen Schere oder dem Bastelmesser
die Form optimiert werden.
Die Schließe
wird am vorderen Gurtteil befestigt und liegt ca. in der Mitte des
Kanisters. Zuerst die Schließe am Band befestigen. Sie sollte
beweglich bleiben!
Dann das Band an der Halterung befestigen. Beides geht am Besten wenn der Halter noch nicht am Turm montiert ist!
Auf
der Rückseite wird der längere Gurtteil befestigt. Dieser
muß dann durch die Befestigungsöse am Turm gefädelt
werden. Das geht nur wenn die Öse ausreichend weit geöffnet
ist. dazu muß vermutlich etwas nachgeholfen werden. Das
angedruckte Teil kann durch winzige Hilfsstege möglicherweise
blockiert werden oder von der Lackierung zugesetzt sein. Beim Reinigen
sollte man äußerst vorsichtig sein, da dieses Teil sehr
empfindlich ist und leicht abbricht. Sollte das passieren, hilft nur zwei
kleine Löcher bohren und einen aus Messingdraht gebogenen Ersatz
einzukleben.
Bei mir ging alles gut, aber das
einfädeln des Gurtes trieb mir nochmal den Schweiß auf die
Stirn. Den Halter sollte man nun erst am Turm festkleben!
Dann wird der Kanister, mit dem Verschluß in Fahrtrichtung,
in den Halter gestellt und der Gurt unter den Tragegriffen des
Kanisters hindurch zugezogen. Nachdem er durch die Schließe
gefädelt und festgezurt wurde, kann das überstehende Ende
passend gekürzt werden, fertig.
An der vorderen Oberwanne
wird neben den Beleuchtungshaltern auch noch eine rechtwinkliges
Rohrteil verbaut, dessen genau Funktion mir nicht ganz klar ist. Ich
vermute es gehört zur Belüftung des Innenraumes. Sein eines
Ende wird in eine Bohrung neben dem Fahrerluk eingeklebt. Die
Außenenden werden mit zwei Subminiaturschrauben angeschraubt.
Dazu müssen erst Löcher in das Schutzblech gebohrt werden, da
die vorhandenen nicht passen.
Die Antennensockel werden in
den Aufnahmen hinter dem Kommandantenluk montiert. Die linke hat einen
berseits angedruckten Sockel auf den nur die Feder mit der
Antennenaufnahme montiert werden muß. Dazu wird das untere
Federende einfach aufgeschraubt. Wie eine Schraube läßt es
sich problemlos auf den Sockelstift schrauben, ohne kleben oder
sonstige Hilfsmittel.
Der zweite Sockel wird dagegen auf die
Halteplatform geklebt. Zur Ausrichtung der Schrauben gab es leider
keine passenden Bilder, daher erfolgte dies aus dem Bauch heraus.
Die
passenden Antennendrähte werden erst ganz zum Schluß
montiert. Sie bestehen aus einen Stahldraht auf dessen Spitze man eine
kleine, tropfenförmige Kugel montieren sollte. Diese war auch an
originalen Antennen verbaut und diente als Schutz gegen Verletzungen,
wenn die Antenne heruntergebogen wurde um sie festzumachen.
|

| 
| | Auf beiden Seiten wird je ein Kanisterhalter mit Kanister installiert. | An der vorderen Oberwanne wird das Belüftungs/Abluftrohr befestigt. | 
| 
| | Einer der beiden Antennensockel | Der Zweite sitzt rechts davon. |
In
wie weit man den Turm mit weiterem Gerödel dekorieren will ist
jedem selbst überlassen. Man kann dazu eine Vielzahl von Bildern
aus dem Internet konsultieren. Es sollte aber unbedingt darauf geachtet
werden, das man die A2 Version zum Vorbild nimmt, denn die beiden
Versionen unterscheiden sich bei den außen angebrachten
Materialien ganz erheblich.
Ich werden diese Ausstattung erst in
einigen Wochen vornehmen, da zum Einen noch die RC-Ausrüstung
nachgerüstet werden muß und zum Anderen noch weitere Modelle
aus diesem Zeitraum auf ihre Fertigstellung warten. Diese dann
einheitlich abzuarbeiten ist sinnvoller.
|
| Fazit des Modelbaus
Der
M103A2 war mein erster Bausatz aus dem 3D Drucker und auch der erste
bei dem die RC-Ausstattung nicht inklusive war. Ich muß sagen ich
war sehr positiv überrascht und erstaunt über die
Möglichkeiten und Detaillierung des Modells. Leider fehlten einige
wichtige Dinge. Besonders eine ordendliche Bauanleitung, es kann auch
nur eine Explosionszeichnung sein, ist unendbehrlich, ebenso wie eine
Teileliste. Mir war es garnicht möglich den genauen Umfang des
Kits auf Vollständigkeit zu prüfen. Das sei dem Hersteller in
diesem Fall verziehen, denn der Kit war nicht im Sortiment und für
mich quasi reanimiert worden. Dennoch ist eine Montageanleitung
unverzichtbar.
Viele kleine Arbeiten und Fehler hätten so von vorneherein vermieden werden können.
Das
Modell weist einige Ungenauigkeiten auf, wie die Sache mit dem
Fahrerluk oder der Position der Halterung für den Scheinwerfer am
Turm, die Kanister sind auch inkorrekt, die Gußmarken am Turm
fehlen teilweise, die Federbeine sollten überarbeitet werden und
die Lücken unter dem Turmdrehring, etc..
Alle diese
"Mängel" sind in der Produktion der nächsten Bausätze
durch wenige Mausklicks zu beheben und waren bei mir keine
modellbauerische Herausforderung. Mir hat es Spaß gemacht eben
diese Details zu erkunden und abzuändern oder zu ergänzen.
Beeindruckend
ist die Konstruktion und das Kit Design. Hier bekommt man nicht nur
viele Details für sein Geld, sie sind auch schon fix und fertig
und bedürfen nur minimaler Nacharbeiten! Der 3D Druck
eröffnet hier Möglichkeiten die vorher nicht gegeben waren,
wie den Druck hohler Körper und den Einsatz passender Materialien.
Was
mir zum perfekten Modell noch fehlt, ist die korrekte Metallkette mit
Gummipolstern und das dazugehörige Laufwerk mit gummibelegten
Laufrollen etc..
Da es jetzt ein neues, wenn auch rudimentäres
M60 Modell gibt, dauert es warscheinlich nicht mehr lange, bis auch die
passenden Ketten, etc. für den M103 bereit liegen. Die M60 Familie
hat eine derart große Vielfalt an Fahrzeugtypen, das es sicher
bald mehr Modelle davon gibt.
Der Zusammenbau und die Lackierung
sind keine außergewöhnlich modellbauerische Leistung, Man
sollte aber einige Erfahrung haben im Umgang mit unterschiedlichen
Materialien. Der verwendete Kunststoff ist mir vorher relativ unbekant
gewesen und es wäre hilfreich mehr über seine genauen
Eigenschaften zu wissen. Er läßt sich nicht gut mit
Sekundenkleber kleben, wenn er nicht angerauht ist und bedarf einer
gründlichen Vorbereitung beim Lackieren. Ohne Silikonentferner und
PUR-Grundierung geht hier nichts.
Hat man das erkannt läuft
der Rest wie geschmiert. Die Teile passen perfekt zusammen und
bedürfen nur wenig Nacharbeit und das Endergebnis ist schon als
Standmodell beeindruckend!
M60A2 ich komme....
| RC Anlage Einbau und Test
Seit
meinem letzten Eintrag ist mittlerweile mehr als ein Jahr
vergangen. Es fand sich einfach nicht die Zeit sich zu kümmern.
Doch manchmal spielt die Zeit auch für einen und in diesem Fall
ist es der passende Empfänger, denn man für diesen Panzertyp
benötigt und der erst jetzt in "Reichweite" kam. Gemeint ist ein
Importeur für die Tongde M60 Modelle in Deutschland, der auch die
passenden Ersatzempfänger anbietet. Über diesen habe ich
mir einen Empfänger von Tongde, der weitestgehend dem TK7.0
von Heng Long entspricht, besorgt. Ich habe die Erwartung das zumindest
der Sound dem des M60 entsprícht, ansonsten würde es auch
die TK7.0 oder TK7.1 oder jede andere Platine tun, welche die Kanone
über Servos hebt und zurückfährt.
Da
der M103 eine IR-Version ohne BB-Kanone ist benötigt er noch eine
Blitz-LED und den IR Sensor um einen Kampf zu bestreiten. Da mich das
nicht wirklich reizt, bereite ich deren Einbau vor, schließe aber
keinen Sensor an. Für die die das machen sei gesagt, daß der Sensor
vorne rechts im Turm unter der Ladeschützenluke seinen Einbauplatz
findet.
Auch
wenn der M103 eine sehr großen Eindruck
macht, so ist sein Innenraum vergleichsweise klein. Das kommt daher da
die Wanne halbrund ist und so der Platz in den Ecken fehlt. Der
Hersteller liefert mit dem Modell auch passende 3D-gedruckte
Kasteneinsätze die mit der Wanne verschraubt werden und die
Elekrtonik aufnehmen. Zudem ist der Turm innen bereits fertig montiert
und muß eigentlich nur angeschlossen werden. Eigentlich bedeutet,
daß es wie immer ein paar Dinge anzupassen gibt. So ist der
Anschluß des Motors welcher die Kommandantenkuppel dreht, genau
wie beim M113 zu klein und das Kabel viel zu kurz. Man kann sich hier
ein passendes Adapterkabel suchen und alt dabei werden oder einfach ein
passendes anlöten! In wieweit die Kuppel sich mit dem Motor drehen
läßt muß ich noch testen, aber ich vermute mal stark,
daß es die gleichen Probleme wie beim M113 geben wird, wo die
Reibung stärker als das Motorgetriebe war (siehe M113 Baubericht).
Dazu später mehr.
Zuerst lege ich mal die Empfänger,
den Lautsprecher, Akku und Rauchgenerator im Innenraum aus um deren
Anordnung festzulegen. Ist ein bisschen wie LEGO. Man probiert so lange
bis es paßt. Dabei muß den Besonderheiten der Konstruktion
Rechnung getragen werden. Die hintere Oberwanne ist als
schnell abnehmbar ausgelegt und nur mit Magneten befestigt. Dies
ermöglich den einfachen Zugriff auf alle Komponenten, die hinter
dem Turm verbaut sind!
Die vordere Oberwanne, mit Turm, ist in der
Mitte eingehakt und wird vorne mit zwei Schrauben befestigt. Ich habe
diese ursprünglichen Kreuzschlitzschrauben durch
Innesechskantschrauben ersetzt, da diese besser einzudrehen sind und
der Schraubenkopf bei häufigem Öffnen und Schließen
nicht so stark leidet. Zudem sind die schwarz brünierten
Innensechskantschrauben unauffälliger.
Der Turm hat eine
stabilen Zahnkranz, der von einem ebenfalls stabilen Stahlritzel
über einen Getriebemotor in der Wanne bewegt wird. Dagegen sind
die üblichen Antriebe der Serienhersteller gerade zu
lächerlich unterdimensioniert. Obwohl der Turm kugelgelagert ist,
hat er doch ein enormes Gewicht, nicht zuletzt durch den Bleibalast,
der das Kanonenrohrgewicht ausgleichen muß!
Aus dem Turm
kommen folgende Kabel, die mit dem Empfänger verbunden werden
müssen. 2 Servoanschlüsse für Rohrhebung und
Rückstoß, 1 Lampenanschluß des IR-Scheinwerfers (nicht
zu verwechseln mit der IR Schießeinheit/Sensor), 1 Anschluß
Komandantenlukdrehung, 1 MG Beleuchtung und dann noch 1 IR-Sensor und 1
Schußblitz.
Alle Kabel benötigen ausreichende
Länge, da der Turmkranz 360° drehbar ist und sich ein
entsprechender Kabelbaum von Heng Long dafür nicht eignet!
Der
verbaute Zahnkranz hat zudem eine Besonderheit. Man kann den Turm
anheben und so den Kontakt zum Ritzel übergehen. Dadurch kann man
den Turm in abgeschaltetem Zustand einfach anheben und wieder in
Fahrtrichtung zurücksetzen oder falls er überdreht ist und
die Kabel verwickelt sind bequem zurückdrehen ohne den Akku zu
strapazieren.
Zudem ist der Turm gesichert gegen herausfallen, denn erläßt sich nur einen begrenzten Weg anheben!
Ich
habe fast einen ganzen Nachmittag damit verbracht die Beleuchtungskabel
für Rücklicht und Fahrtlicht weiß, rot, tarn zu
optimiern und zu verlöten. Da die hinteren LEDs sehr dicht am
Getriebe sitzen und fast mit den Zahnrädern kollidieren muß
man hier besondere Vorsicht walten lassen um eventuelle
Kurzschlüsse im Betrieb zu vermeiden. Die Zuleitungen werden
gebündelt und unter dem Getriebeblock durch, zum Empfänger
geführt.
Genauso verhält es sich mit der vordern
Beleuchtung die allerdings aus drei getrennten Kreisen besteht, von
denen leider nur einer am Empfänger einen Steckplatz hat,
nämlich die weiße Beleuchtung. Alle Kabel habe ich mit Kabelbinder zu einem Kabelbaum zusammengebunden, der links am Turm entlang geführt wird.
Die
optionale rote und gelbe Tarnbeleuchtung muß über eine
externe Platine zur Lichtsteuerung geschaltet werden, was bei dieser
Platine meines Wissens nach nicht geht. Daher werden diese
Anschlüsse nur bereitgestellt und nicht angeschlossen. Man
weiß ja nie welche neuen Empfänger noch kommen...
Die
Motoren werden wie gewohnt über M1 und M2 angeschlossen. Das gilt
auch für den Hauptschalter und den Lüfter, sofern notwendig.
Der LiPo-Akku (für mehr ist kein Platz!) macht mir die
größten Probleme, da es für ihn nur einen Platz unter
der Fahreluke gibt, dort aber schon der Fahrer platz genommen hat!
Zudem wäre mir ein Platz im Heckbereich, wegen des
Schnellzugriffes eigentlich lieber. Hier ist das letzte Wort noch nicht
gesprochen.
Lautsprecher und Rauchgenerator kämpfen derzeit noch
um den Platz zwischen den Getrieben, aber es sieht so aus als ob der
Rauchgenerator den gewinnt. Der Lautsprechen muß sich dann mit
dem Platz direkt unter dem Turm zufrieden geben.
Zum Rauch sei
gesagt, das am Modell keine Öffnung für den Auspuff
vorgesehen ist. Grund hierfür ist, daß die Abgase durch das
Gitter am Heck geleitet werden. Das erkennt man am Ruß der sich
dort abgelagert hat. Hier eine Öffnung zu schaffen ist aber
schwierig, da man nicht einfach ein Loch bohren kann ohne die Rippen
des Gitters zu beschädigen. Eine funktonierende Lösung steht
derzeit noch aus. Möglicherweise baue ich den Rauchgenerator
einfach nicht ein.
Ist der Wanneneinbau der Fahrelektronik erfolgt,
kann man die Wanne, ohne Turm, erst einmal auf ihre Fahreigenschaften
hin testen. Dabei immer an die Stoßdämpfer denken, welche
dazu neigen sich beim Anheben zu verkeilen! Ich lasse daher das Modell
auf einem dünnen Brett und fahre es davon runter und
abschließend wieder darauf.
Der
Fahrtest lief überraschend gut auch die Beleuchtung funktioniert
einwandfrei, nur der Turm dreht nur schwer und hat offensichtlich ein
Gewichtsproblem, da die Kanone noch nicht eingebaut ist. Rohrhebung und
Rückzug funktionieren auch nicht. Das bedeutet nochmal alles
prüfen und sehen was falsch läuft.
Beim Turm vermute ich,
daß es sich nur um das fehlende Rohr handelt, welches quasi ein
Gegengewicht zum Turmheck und den darin eingebauten Gewichten
darstellt. Da der Turm Kugelgelagert ist kann es nicht an der Reibung
liegen.
Ich habe den Empfänger direkt unter dem Turm
plaziert, da sich die Kabel so besser mitdrehen können. Der Akku ist
vorläufig direkt vor dem Getriebe gelagert, damit man ihn
über die nur mit Magneten gehaltene Motorabdeckung einfacher
erreicht. Da ich den Panzerfahrer gerne weiter aus der Luke schauen
lassen möchte, bleibt kein anderer Platz. Verzichtet man auf den
Panzerfahrer kann man den Hauptschalter und den Akku mit
Ladeanschluß unter dieser Luke installieren und über selbige
bedienen. Über das Heck läßt sich aber der gesamte Akku
leichter entfernen und auch extern laden.
Der Lautsprecher gab
im Test überraschenderweise keinen Ton von sich, was vermuten
läßt, das er abgeschaltet ist. Das ist ein weiterer Punkt
auf meiner Checkliste ist. Das die Servos nicht ansprachen liegt
möglicherweise auch daran oder sie wurden vielleicht verpolt. Der
nächste Punkt auf der Checkliste.
Die Diode für den Schußblitz muß ich erst noch besorgen. Aber die sollte ja das kleinste Problem sein.
Ein
neuer Tag ein neues Problem. Die Servos haben sich als einfach nur
"verpolt" herausgestellt. Soweit so gut, aber kaum gelöst ergab sich
ein Problem mit der Anlenkung an das Geschütz. Die Mechanik bedarf der
Feinjustierung. Selbiges gilt für den Rohrrückzug, der sich leider
bisher nicht auslösen ließ.
Im Falle des Turmdrehmechanismus
mußte ich leider feststellen, daß dem Motor die Kraft fehlt auch nur
den geringsten Widerstand zu überwinden. Der, mit einem Getriebe
bestückte, Motor hat zwar ein fettes Stahlritze, wenn man das aber nur
leicht festhält bleibt er stehen. Große Übersetzung aber wenig Kraft.
Lege ich nur den Zahnkranz ein dreht der sich perfekt in beide
Richtungen. Kommt aber das geringste Hindernis, z.B. klemmt ein Kabel
oder gibt es eine Schieflage des Fahrzeuges steht der Turm sofort. Hier
braucht es mehr Kraft! Problematisch ist, das Motor und Getrieben
herstellerseitig geliefert wurden und offensichtlich (nach dem
aufgeklebten Lable) für 12V ausgelegt sind. Die Platine liefert aber
für die normalen Tongde/Heng Long Turmantriebe meist nur 5-6V. Als
alter "Elektriker" weiß ich aber das die Spannung den Spaß bringt und
der Strom das Drehmoment. Leider sind mir die Kenndaten der Platine
nicht bekannt und sie stehen auch nicht in der Betriebsanleitung! Das
ist wieder ein neues Problem.
Den Antrieb einfach gegen einen
Standardantrieb von Tongde/Heng Long zu tauschen geht auch nicht, da
diese Antriebe von außen auf den Zahnkranz wirken, der im Modell wird
aber von innen angetrieben. Kurze Denkpause!
|
Hier endet der Baubericht vorläufig.
|
|